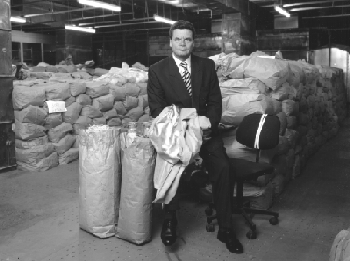Joachim Gauck, geb. 1940 in Rostock, studierte nach dem Abitur Theologie. Als Pfarrer in Lüssow bei Güstrow und später im Neubaugebiet Rostock-Everhagen wurde Gauck durch seine offenen und kritischen Worte bekannt. 1989 gehörte Gauck zu Mitbegründern des "Neuen Forums" in seiner Heimatstadt. Dort war er Mitiniator des kirchlichen und öffentlichen Widerstands gegen SED-Diktatur. Wenig später zog er als Abgeordneter der Bürgerbewegung im März 1990 in die Volkskammer ein und wurde zum Vorsitzenden des Parlamentarischen Sonderausschusses zur MfS-Auflösung gewählt.
Nach der Wahl durch die Volkskammer zum 3. Oktober 1990 vom Bundespräsidenten und Bundeskanzler zum "Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes" berufen.
Seit Verabschiedung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes des Deutschen Bundestages Ende 1991 "Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik" mit Dienstsitz Berlin. Am 21.09.1995 wurde Joachim Gauck für seine 2. Amtsperiode vom Deutschen Bundestag bestätigt.
Er ist 1991 zusammen mit fünf weiteren ehemaligen DDR-Bürgern (unter ihnen Jens Reich und Ulrike Poppe) mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet worden.
Im September 1995 erhielt Joachim Gauck aus der Hand von Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog das Bundesverdienstkreuz.
TENDENZEN: Manche Leute rümpfen die Nase, wenn Sie als Pfarrer - und damit als bekennender Christ, was ja heute nicht immer unbedingt deckungsgleich sein muß - für das Aufarbeiten vergangener Sünden eintreten. Was würden Sie diesen Leuten antworten?
GAUCK: Folgendes sei vorangestellt: Für meine jetzige Aufgabe mußte ich meine Ordinationsurkunde abgeben. Ich bin also nicht mehr Pfarrer. Bekennender Christ bin ich geblieben, und das ist mir heute sehr oft hilfreich. Christ zu sein bedeutet für mich nicht, jegliche Schuld kommentarlos zu vergeben, insbesondere nicht, wenn dadurch Menschen an Leib und Seele zu Schaden gekommen sind.
Wir hätten es bequem haben: Wir hätten die rund 180 km Material, die uns die Stasi hinterlassen hat, vermauern oder verbrennen können und hätten dann - zumindest oberflächlich - unsere Ruhe gehabt. Doch wir haben uns für die Aufarbeitung entschieden, weil wir ein Gespür dafür hatten, wie nützlich der Schlußstrich für die Unterdrücker von einst gewesen wäre. Der Schlußstrich klingt so christlich, aber seine Auswirkungen sind in aller Regel eine Begünstigung der Repression und der Diktatoren, die die Repression ausgeübt haben.
TENDENZEN: An welchem markanten Ereignis könnten Sie diese Haltung festmachen?
GAUCK: Als die jungen Leute in Scharen über Ungarn in die Bundesrepublik flüchteten, schrieb die SED-Zeitung "Neues Deutschland": "Denen weinen wir keine Träne nach!" Das brachte Tausende auf die Barrikaden. Zu diesem Zeitpunkt war noch überhaupt nicht klar, wer die Stasi war, und wie sie war. Wir hatten Vermutungen, mehr nicht. Und dann stellte sich heraus, daß der alte Apparat in den neuen Strukturen bereits wieder fleißig seine Netze spann. Ich erinnere nur an die Enttarnung des Vorsitzenden der Ost-SPD und des Vorsitzenden der Partei Demokratischer Aufbruch. Der Ruf "Stasi in die Produktion!" bedeutete: Wir wollten diese Stasi-Leute nicht aufgeknüpft sehen - sie sollten nur genauso normal leben andere auch. Und sie sollten nicht wieder über andere Macht ausüben können.
TENDENZEN: Wie schätzen Sie den politischen Instinkt derer ein, die 1989 auf die Straße gingen?
GAUCK: Sie wollten nicht mehr immer nur Ja sagen und Nein denken. Die Verlogenheit des Systems hatte ein Ausmaß erreicht, daß es fast körperlich schmerzte. Dagegen haben die Menschen sich gewehrt, weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Sie wußten nicht genau, was der Westen ist, aber sie wußten, was der Osten ist. Und den wollten sie so nicht mehr.
TENDENZEN: Manche Ihrer Kritiker halten Ihnen den paulinischen Satz "Wir sind doch allzumal Sünder" entgegen. Sie wollen damit erreichen, daß Sie und Ihre Behörde endlich die Akten der Vergangenheit schließen.
GAUCK: Dieser paulinische Satz wird gern von denen in den politischen Raum gehoben, die entschuldigen und relativieren wollen. Das ist aber etwas anderes als christliche Vergebung. Die paulinischen Briefe rechtfertigen oder entschuldigen nicht das Böse. Für Christen ist Vergebung unerläßlich, doch sie erwächst nicht aus menschlicher Weißwäscherei. Aufarbeitung ist schwierig und tut weh. Man sieht sich selbst, und man mag sich nicht: "Ich habe geschwiegen, als ich hätte reden müssen; ich habe weggeschaut, als ich hätte eingreifen müssen." Aber wir müssen genau hinsehen, sonst bleiben wir traumatisiert. Wir müssen aufarbeiten, um uns zu befreien. Wenn wir noch etwas aufzuarbeiten haben, dann werden wir das tun müssen, oder wir werden unglaubwürdig. In den Akten erkennt man auch, daß manche den Mut hatten, nein zu sagen.
TENDENZEN: Sie haben in Ihrem Vortrag den großen Mangel an Zivilcourage angeführt, und ein deutscher Dichter hat einmal geschrieben "Zivilcourage wiegt weitaus mehr als Heldenmut". Wo also setzt man mit Zivilcourage in einer Diktatur auf subtile Weise ein Signal?
GAUCK: Das beginnt mit der Verweigerung der Begeisterung.
TENDENZEN: Wie können Sie unser Versagen als Deutsche der braunen und der roten Diktatur auf einen Nenner bringen?
GAUCK: Die Deutschen ließen sich zu Untertanen machen. Vielleicht ist diese Haltung begründet in der Tatsache, daß Deutsche in ihrer Geschichte mit demokratischen Staatsformen wenig Erfahrung gemacht haben. Es gab ja nur die Weimarer Republik, und in der ging es - gelinde gesagt - drunter und drüber. Ich glaube nicht, daß es ein Gen gibt, das den Deutschen zum potentiellen Untertanen macht und den Franzosen nicht.
TENDENZEN: Aber wie ist das mit den Deutschen, wenn die Diktatur fällt?
GAUCK: Es ist schwer, das Gehabe des Untertans loszuwerden. Menschen werden in ihrer Mentalität um so intensiver geprägt, je länger der Druck der Diktatur dauert. Unter solchen Systemen verliert der Mensch einen Teil der Fähigkeit, selbstbestimmt zu leben. Viele glauben dann, es sei normal, nicht über sich selbst bestimmen zu können. Wenn die Diktatur fällt, sind die Menschen zunächst orientierungslos und damit leicht zu manipulieren, natürlich auch für neue Diktatoren. Daß sich im Westen Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg eine Demokratie, im Osten aber eine neue Diktatur entwickelte, lag nicht daran, daß westlich der Elbe die besseren und klügeren Deutschen wohnten. Jede Besatzungszone wurde im Grunde genommen zunächst nach dem Vorbild der Besatzer orientiert.
TENDENZEN: Wie wirkt sich eigentlich Gehirnwäsche selbst bei hochintelligenten Untertanen in einer Diktatur aus?
GAUCK: Es gibt einen Verlust von Wirklichkeit für jeden Menschen, der unter totalitärer Herrschaft lebt. Jede Wahrheit kann zur Lüge und jede Lüge zur Wahrheit gemacht werden. Der Untertan ist durch jahre- oder jahrzehntelange Prägung darauf ausgerichtet, immer ganz dicht bei der Meinung der Herrschenden zu sein. Nur dadurch kann er überleben. Motto: Beuge dein Haupt, passe dich an, und es wird dir gut gehen. Der Grad der Intelligenz spielt dabei keine Rolle. Wer weiterkommen will, ordnet sich unter.
TENDENZEN: Was sagen Sie zur Nostalgie in weiten Kreisen der ehemaligen DDR?
GAUCK: Es sei im Sozialismus nicht alles schlecht gewesen, höre ich heute immer wieder, und dann kommt in aller Regel das Argument mit den Kindergärten. Es liegt in der Natur des Menschen, sich im Nachhinein zuerst an das vermeintlich Gute zu erinnern, und es gibt politische Strömungen in diesem Land, die das unterstützen. Gern vergessen wird bei dieser Art der Rückschau das Fehlen aller fundamentalen Werte der Demokratie in der DDR wie beispielsweise Bürgerrechte, Gewaltenteilung und freie Meinungsäußerung. Ich habe den Eindruck, daß sich eine Reihe von Menschen - unbewußt - nach der alten Ohnmacht sehnt. Die war so schön bequem. Wer vom Westen nur das große Auto und die Pauschalreise nach Mallorca wollte, mußte begreifen, daß das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Auch die freiheitlich demokratische Grundordnung ist nicht der Himmel auf Erden. Doch ich bitte gleichzeitig um Geduld: Wer jahrzehntelang fremdbestimmt lebte, kann nicht von heute auf morgen umdenken. Man kann nicht ein ganzes Volk mit einem Bekehrungsakt vom Stadium des Aberglaubens in das Stadium des Aufgeklärtseins bringen. Dies ist ein Prozeß, der noch einige Jahre andauern wird, und die Öffnung der MfS-Akten trägt einen Teil zur notwendigen Aufklärung bei.
TENDENZEN: Das ist also so ähnlich wie nach dem Untergang des Dritten Reiches?
GAUCK: Vor einiger Zeit fiel mir eine Allensbach-Studie aus dem Jahr 1948 in die Hände. Die Frage lautete damals: "Glauben Sie, daß der Nationalsozialismus eine gute Sache war, die nur schlecht gemacht worden ist?" Damals bejahten 57 Prozent der Befragten, frei nach dem Motto: Der Führer hat die Autobahn gebaut; es gab Vollbeschäftigung und keine Kriminalität. Und dies nach einer "nur" zwölfjährigen Diktatur. Die DDR gab es 40 Jahre!
TENDENZEN: Im Grunde waren es doch in diesem Jahrhundert die Christen hierzulande, die gegenüber den Diktaturen größtenteils versagt haben. Was läßt die Untertanen oft so fasziniert auf den Obertan schauen?
GAUCK: Wie Václav Havel sagte: Die Macht der Mächtigen kommt von der Ohnmacht der Ohnmächtigen. Es gibt keine Kirche, keine Religionsgemeinschaft, die von Verstrickungen mit den jeweiligen Machthabern im Staat verschont geblieben ist. Mitunter ist die evangelische Kirche in der DDR um der Aufrechterhaltung des Dialogs willen mit der Staats- und SED-Führung Kompromisse eingegangen, die uns heute fragwürdig erscheinen. Auch Christen sind der Versuchung erlegen, mit der Staatssicherheit zusammenzuarbeiten. Von "fasziniertem Schauen auf den Obertan" möchte ich aber nicht sprechen. Schließlich war es auch die evangelische Kirche, die in der DDR zu den Wegbereitern der friedlichen Revolution gehörte. Vielfach hatte sich in den Gemeinden und Synoden eine demokratische Gegenkultur entwickelt, die den Aufbruch 1989 begünstigte.
TENDENZEN: Welchen Rat gäben Sie jungen Leuten, die an diesem Abend Ihrem Referat lauschten?
GAUCK: Man darf nicht jedem Streit aus dem Wege gehen. Es gibt eine scheinbare Friedlichkeit, die nur Aggressionsgehemmtheit darstellt. Ein produktiver Streit ist mir wesentlich lieber als stille Resignation. Ich fordere auch die jungen Leute auf, Demokratie mitzugestalten, sich einzumischen, ihre Meinung zu vertreten. Jeder von uns ist für sich und sein Handeln selbst verantwortlich. Aber jeder von uns ist auch ein Mitglied dieser Gesellschaft, und wir müssen gemeinsam dafür sorgen, daß in Deutschland nie wieder eine Minderheit die Macht über die Mehrheit erlangt.
TENDENZEN: Sind Ihnen Fälle bekannt, daß nach Einsichtnahme in Akten Wiedergutmachungsprozesse geführt wurden?
GAUCK: Allein bis zum Ende des vergangenen Jahres wurden an meine Behörde weit über 50 000 Anträge auf Akteneinsicht bzw. Herausgabe von Unterlagen zum Zwecke der Rehabilitierung und ca. 30 000 Anträge zum Zwecke der Wiedergutmachung gestellt. Im Verhältnis zur Gesamtzahl aller an den Bundesbeauftragten gerichteten Ersuchen von ca. 3,4 Millionen nehmen sich die Zahlen gering aus, und doch ist mir dieser Bereich unserer Tätigkeit einer der wichtigsten. Wer in der Sowjetischen Besatzungszone oder später in der DDR zu Unrecht verurteilt war, wer in der Haftzeit physische oder psychische Schäden erlitt, der hat ein Recht darauf, rehabilitiert zu werden oder finanzielle Entschädigung zu erhalten. Oftmals finden sich nur in den von der Staatssicherheit angelegten und archivierten Aktenbeständen die für den Nachweis etwa von finanziellen Ansprüchen notwendigen Unterlagen.
TENDENZEN: Sind Ihnen Fälle bekannt, wo sich Menschen, die vorher bespitzelt wurden, nach Aussprache mit "ihren" Bespitzelern versöhnten?
GAUCK: Ja, auch das gibt es, aber eher selten. Als das Stasi-Unterlagen-Gesetz in Kraft getreten war, und die Menschen begannen, in die über sie geführten Akten Einsicht zu nehmen, befürchteten verschiedene Kreise in diesem Land eine Welle der Selbstjustiz. Dazu ist es dank der Vernunft und der Weitsicht der ehemals Bespitzelten nicht gekommen. Leider treffe ich jedoch selten auf ehemalige inoffizielle oder hauptamtliche MfS-Mitarbeiter, die dazu bereit sind, ihren persönlichen Teil von Verantwortung und Schuld einzugestehen und sich damit aktiv auseinanderzusetzen, die auf die Geschädigten zugehen und mit ihnen gemeinsam versuchen, Erklärungen für ihr Verhalten zu finden. Versöhnung ohne die Frage nach der Wahrheit und den Gründen für einstiges Handeln aber ist nicht möglich.
(Das Gespräch führten Heinz und Sigrun Schumacher)


 Prof. Joachim Fest
Prof. Joachim Fest Claus Jacobi
Claus Jacobi Prof. Dr. Michael Stürmer
Prof. Dr. Michael StürmerB.Strauss_SV.jpg) Marcel Reich-Ranicki
Marcel Reich-Ranicki Dr. Edmund Stoiber
Dr. Edmund Stoiber Mainhardt Graf von Nayhaußen
Mainhardt Graf von Nayhaußen Danièle Thoma
Danièle Thoma