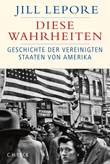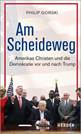VOM BILOGISCHEN MENSCHEN ZU POSTHUMANEN WESEN
Die transhumanistische Herausforderung
Die Zeit der Menschheit ist fast abgelaufen - sagt Max More, Chefphilosoph und Visionär der Extropianer - nicht weil wir uns selbst zerstören, sondern weil wir unsere Menschlichkeit überschreiten werden.
Von Von Max More
Wir werden zu transhumanen Personen, während wir ins posthumane Zeitalter eintreten, indem die menschlichen Grenzen überwunden werden. More begründet in seinem provokativen Manifest, warum für ihn die Zeit der biologischen Menschen abgelaufen ist.
Max Morehat in England Philosophie studiert und siedelte anschließend nach Kalifornien über. Zusammen mit Tom Morrow begründete er Extropy, ein "Journal für transhumanistisches Denken" und das Extropy Institute, dessen Leiter er ist. Die Weltanschauung der Extropianer zieht immer größere Aufmerksamkeit auf sich. Die Zeit scheint reif für die Umwandlung des Menschen zu sein.
Die transhumanistische Herausforderung
Ich lehre euch den Übermenschen. der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden?
Friedrich Nietzsche "Also sprach Zarathustra"
Die Evolution hat die geistlose Materie in eine aufsteigende Spirale getrieben und immer mächtigere Nervensysteme entwickelt. Das Leben setzte mit gänzlich unbewußten chemischen Reaktionen ein. Daraus entwickelten sich einfacheTropismen, auf die Instinkte und Reiz-Reaktions-Verhaltensweisen im Sinne Skinners folgten. Mit dem Menschen entstand bewußtes Lernen und bewußte Erfahrung. Die Geschwindigkeit des Fortschritts beschleunigte sich enorm mit der Einführung des begrifflichen Bewußtseins und schließlich mit der wissenschaftlichen Methode. Extropianer und andere Transhumanisten wollen diesen evolutionären Prozeß mithilfe von Wissenschaft, Technik und Philosophie noch weiter beschleunigen. Mit der Verwerfung von alten Mythen und dem Einsatz von wirsamen neuen Werkzeugen können wir die biologischen und psychologischen Grenzen transzendieren, um posthumane Wesen zu werden.
Zu diesem Zweck müssen wir alle natürlich und kulturell verwurzelten Beschränkungen unserer Möglichkeiten beseitigen. Extropianer befürworten den prometheischen Gebrauch von Wissenschaft und Technik, um immer tiefere und umfassendere Verbesserungen des menschlichen Seins zu erzielen - um den biologischen Prozeß des Alterns und des unerwünschten Sterbens auszurotten, um unsere Intelligenz über die Kapazitäten unseres biologischen Gehirns hinaus zu vergrößern, um uns die Entscheidung über unsere körperliche und psychische Identität zu ermöglichen, anstatt uns mit der Identität zufrieden zu geben, mit der wir geboren wurden.
Wir verstehen Technik als eine natürliche Erweiterung und als Ausdruck des menschlichen Intellekts und Willens, der menschlichen Kreativität, Neugier und Imagination. Wir prophezeien und fördern die Entwicklung einer Technik, die immer flexibler, klüger und anpassungsfähiger wird. Wir werden mit den Produkten unseres Geistes in eine Ko-Evolution eintreten und schließlich mit unserer intelligenten Technik in eine posthumane Synthese verschmelzen, die unsere Fähigkeiten erweitert und unsere Freiheit vergrößert.
Die anmaßende Vision der Extropianer erzeugt bei vielen in der gegenwärtigen Welt Angst. Seltsamerweise haben selbst jene, die nicht an einen göttlichen Schöpfer, Hirten oder Sinngeber glauben, Angst davor, "Gott zu spielen". Diese Angst wird besoners in den typischen Reaktionen auf die Möglichkeiten deutlich, den Prozeß des Alterns und den Tod abzuschaffen. Vor dieser Aussicht schrecken viele zurück: Das ist nicht natürlich, Leben ohne Tod würde bedeutungslos werden, Ich will nicht länger als meine zugeteilte Zeit leben. Mit Angst und Schrecken sehen sie nicht nur die körperliche Unsterblichkeit, sondern auch den Erwerb einer übermenschlichen (oder posthumanen) Intelligenz. Viele Episoden der Serie Star Trek zeigen diese Einstellung: Die Überschreitung des Menschlichen bringt Unglück mit sich, was mit der zweiten Episode beginnt, "Where No Man Has Gone Before". Filme und andere Produkte der Massenkultur stellen oft die verheerenden Folgen des wissenschaftlichen Ehrgeizes dar.
Solche Erzählungen erscheinen mir ebenso altbacken zu sein wie die von Ikarus, Frankenstein und dem Turm von Babel: Menschen sollten eben ihre Grenzen anerkennen. Baut keine Flügel! Errichtet keine Türme, die den Himmel durchstoßen! Versucht nicht, Alter und Tod zu überwinden! Heilt die Kranken, aber verbessert nicht die Gesundheit!
Die Transhumanisten stellen sich dieser Haltung entgegen. Transhumanisten verschiedener Art teilen eine zentrale Vision. Wie der Begriff nahelegt, antizipieren Transhumanisten unsere Zukunft als posthumane Wesen und passen dementsprechend ihre Sicht ihres Lebens daran an. Sie sehen eine Zukunft radikaler körperlicher, psychischer und sozialer Veränderungen voraus. Die am besten organisierte Gruppe der Transhumanisten nennt sich Extropianer. Die extropianische Sicht der Technik, wissenschaft, Philosophie und Kunst wird in der Zeitschrift Extropy und in den Publikationen, Versammlungen und Online-Foren des Extropy Institute entwickelt. Die Extropianer haben ein eigenes Verständnis des Transhumanismus, zu dem bestimmte Werte und Einstellungen wie grenzenlose Expansion, Selbstveränderung, dynamischer Optimismus, intelligente Technik und spontane Entstehung von Ordnung gehören (die extropianischen Prinzipien). Extropianer sind auf der Suche nach weiterer Extropie - ein Maßstab für Intelligenz, Information, Vitalität, Erfahrung, Diversität, Möglichkeiten und Wachstum.
Ist der Vorschlag der Extropianer, ein posthumanes Wesen zu werden. nur eine visionäre Phantasie oder gar ein Alptraum? Zur Beantwortung dieser Frage muß ich zunächst zeigen, daß ein posthumanes Wesen wirklich möglich ist. Dann werde ich zeigen, daß der Versuch, ein posthumanes Wesen zu werden, wünschenswert ist und die Gesundheit fördert.
Sind posthumane Wesen möglich?
Der Übergang von einem menschlichen zu einem posthumanen Wesen läßt sich körperlich oder psychologisch und philosophisch begreifen. Körperlich werden wir erst dann zu einem posthumenen Wesen geworden sein, wenn wir unsere Erbanlagen, die Physiologie, Neurophysiologie und Neurochemie, so fundamental und gründlich verändert haben, daß wir sinnvollerweise nicht mehr als Homo sapiens eingeordnet werden können.
Lesen Sie hier den HEUTE AM 26.10.2020 aktualisierten Beitrag vom Telepolis Online vom 17.07.1996 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des Telepolis Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.heise.de/tp
INTERVIEW MIT DAVID FRENCH*
"Natürlich können die USA auseinanderbrechen"
Die permanente Eskalation in der amerikanischen Politik birgt für den Publizisten David French das Risiko, dass es zu einer neuen Sezession kommt. Er bietet Heilmittel an, die im gegenwärtigen Klima geradezu utopisch wirken: Föderalismus, Umsicht, Moral und Tugendhaftigkeit.
* David French ist 51 Jahre alt, Anwalt, Autor und Kommentator - Ein christlich-konservativer Rufer in der Wüste. Er stammt aus dem Umfeld der «National Review» und der Denktradition William Buckleys. Wie andere Anhänger dieser Geistesströmung hat er Donald Trump die Gefolgschaft versagt und der Republikanischen Partei in der Folge den Rücken gekehrt. David French ist 51 Jahre alt, Anwalt, Autor und Kommentator. Er stammt aus dem Umfeld der «National Review» und der Denktradition William Buckleys. Wie andere Anhänger dieser Geistesströmung hat er Donald Trump die Gefolgschaft versagt und der Republikanischen Partei in der Folge den Rücken gekehrt.
French wurde 2016 von der konservativen Anti-Trump-Bewegung der Never-Trumpers in einem letzten Akt der Verzweiflung noch als alternativer republikanischer Präsidentschaftsbewerber ins Spiel gebracht, allerdings ohne jede Chance. Heute publiziert er unter dem Dach des konservativen Internetportals «The Dispatch» seinen Newsletter «The French Press» und lebt in Tennessee. Vor wenigen Wochen ist auch sein jüngstes Buch mit dem Titel «Divided We Fall» erschienen.
Von Peter Winkler, Washington
Präsident Trump schürt Ängste, dass er die Macht nicht freiwillig abgeben wird. Experten entwerfen Szenarien von Chaos oder sogar Gewalt für die Tage nach der Wahl. Und ausgerechnet Sie, Herr French, eine der besonnenen Stimmen in Amerika, sagen jetzt in Ihrem neuen Buch, dem Land drohe eine neue Sezession. Beruhigend ist das nicht!
Wenn ich sage, dass die USA natürlich auseinanderbrechen können, dann will ich darauf hinweisen, dass man nicht ständig polarisieren kann, ohne irgendwann einen Preis dafür zu zahlen. Wir leben in einer Zeit, in der jede Wahl immer gleich zur «wichtigsten in unserem Leben» aufgebauscht wird. Es ist das Argument, das bereits vor vier Jahren vorgebracht wurde, als ein Pamphlet erschien, das die Präsidentenwahl mit dem Flug Nummer 93 der Anschläge vom 11. September verglich [Es war dasjenige Flugzeug, das von den Passagieren zum Absturz gebracht wurde, um einen Angriff auf Washington zu verhindern, Anm. d. Red.]. Da hiess es, wir Konservativen müssten jetzt das Cockpit stürmen, indem wir Donald Trump wählten, oder wir liessen zu, dass das Land ins Unglück stürze.
Es geht schon längst nicht mehr um politische Vorhaben. Was Trump von Joe Biden oder auch von Hillary Clinton inhaltlich unterscheidet, erreicht niemals ein Mass, das Amerika auseinanderbrechen lässt. Aber das ständige Gezerre am Grundgerüst der Nation, das Schüren von Angst und Wut, der Glaube, dass der politische Gegner so bösartig ist, dass das Land nicht überleben kann – das hat ganz reales Zerstörungspotenzial.
Und wie sollen wir das verhindern?
Wir müssen zuerst einmal deeskalieren. Dem Popanz, dass bei den nationalen Wahlen alles auf dem Spiel stehe, Luft ablassen. Wir erleben gegenwärtig in den USA das Paradox, dass das Land einerseits immer diverser wird, sowohl politisch als auch kulturell, ethnisch und auch in Religionsfragen. Andererseits wird die Macht immer stärker zentralisiert. Das hat zur Folge, dass die nationalen Wahlen unser Leben tatsächlich immer direkter betreffen.
Die Mittel, die wir für eine Deeskalation brauchen, sind in der Verfassung bereits angelegt. Es sind die föderalen Strukturen und die Bewahrung der individuellen Freiheit. Diese beiden Prinzipien schützen zum einen die einzelnen Bürger, zum anderen auch Gemeinschaften von Bürgern, die sich darauf einigen, dass sie sich in ihren Gliedstaaten oder Städten selbst regieren wollen. Legte man darauf wieder das angemessene Gewicht, sänke die Temperatur in der nationalen Auseinandersetzung sofort.
Doch das betrifft nur das politische System. Wir haben auch ein grosses kulturelles Problem. Es ist der Kult der Wut, kombiniert mit einem engen Horizont und einem Mangel an Toleranz. Die kulturelle Deeskalation kann nicht vorankommen, solange die Amerikaner nicht bereit sind, toleranter oder gelassener zu werden. In gewisser Weise ist das wahrscheinlich sogar der notwendige erste Schritt.
Gegenwärtig erleben wir aber genau das Gegenteil. Kompromisse werden diskreditiert, Radikalismus wird belohnt.
Das ist es, was mich so beunruhigt. Alle Trendlinien weisen in die falsche Richtung. Darum ist es meiner Meinung nach zwar nicht unausweichlich, dass wir dieses Jahr in eine Verfassungskrise schlittern. Aber zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben ist es absehbar, dass es nach der Wahl tatsächlich dazu kommen könnte.
Vor zwanzig Jahren, bei der Wahl zwischen George W. Bush und Al Gore, war es ja nicht so, dass die Legitimität der Wahl bestritten wurde. Es gab nie einen Zweifel, dass der Verlierer nach der Lösung des Problems mit der Stimmennachzählung seine Niederlage eingestehen und sich friedlich aus dem Rennen zurückziehen würde. Und so kam es auch. Natürlich war hier und da noch Wut spürbar, aber es gab kein Chaos. Aber jetzt ist die Möglichkeit ganz real, dass es zu einem gewalttätigen Chaos kommt. Das müsste die Amerikaner aufwecken. Das müsste sie veranlassen, alles zu tun, damit es nicht dazu kommt.
Sie hoffen offensichtlich, vielleicht von Ihrem christlichen Glauben ermuntert, dass Amerika zur Vernunft, zur Tugend zurückkehrt. Haben Sie manchmal nicht das Gefühl, Sie seien Angehöriger einer aussterbenden Gattung?
[Lacht] Vielleicht im Sinn, dass Anstand und Zuvorkommenheit in der Vergangenheit verwurzelt sind, während der Trend in Richtung Gemeinheit und Boshaftigkeit läuft.
Aber im Ernst: Es gab in der amerikanischen Geschichte immer wieder Episoden, in denen sich das Volk einen Ruck gab und sich entschlossen von destruktiven Trends abwandte. Wir dürfen nicht vergessen, dass es vor der Ära Trump schon eine Ära Richard Nixon gab. Er war wahrscheinlich der gemeinste und korrupteste Präsident der modernen Zeit. Nixon wurde 1974 aus dem Amt gezwungen, und zwei Jahre später wählte Amerika fast das pure Gegenteil, nämlich einen ausserordentlich bescheidenen, aufrichtigen Erdnussfarmer aus Georgia [Jimmy Carter]. Das zeigt, dass das amerikanische Volk gelegentlich in der Lage ist zu sagen: «Genug. Es reicht mit der Boshaftigkeit.»
Aber ich gebe zu, wenn ich die Bemühungen sowohl rechts als auch links sehe, die Spannungen immer weiter eskalieren zu lassen, dann habe ich manchmal schon Mühe mit der Hoffnung, dass Tugend wieder ein Element der Politik werden kann.
In Ihrem Newsletter zitierten Sie kürzlich den Gründervater John Adams, der vereinfacht gesagt meinte, das grossartige Gebäude von Verfassung und Grundrechten könne nur funktionieren, wenn moralische und tugendhafte Menschen am Werk seien. Das klang für mich, als ob Sie über den gegenwärtigen Präsidenten hätten sprechen wollen.
Es ging natürlich um den gegenwärtigen Präsidenten, aber nicht nur. Es geht weit darüber hinaus. Sehen Sie, mit einem gemeinen, inkompetenten Menschen im Weissen Haus können wir fertigwerden. Es gibt dazu genügend «checks and balances», auch wenn das vielleicht nicht ganz ohne Probleme verläuft. Womit wir aber sicher nicht fertigwerden können, ist, wenn die gleichen Einstellungen im amerikanischen Volk überhandnehmen.
Einer der zentralen Punkte der Verfassung ist der Schutz der individuellen Freiheit. Sie schafft die Freiheitsräume, welche die amerikanischen Gemeinschaften und Individuen wie Sauerstoff umgeben. Das macht es aber auch unglaublich wichtig, wie wir mit diesen Freiheiten umgehen.
Der Gesellschaftsvertrag zwischen Volk und Regierung hat zwei Seiten. Er auferlegt der Regierung, die Freiheit des Individuums zu schützen. Es ist aber nicht ihre Aufgabe, uns zu tugendhaften Menschen zu machen. Es ist unsere ureigene Verantwortung, diese Freiheit in tugendhafter Weise auszuüben. Natürlich ist da niemand perfekt, das wäre ein vermessener Anspruch. Aber man kann sich eine einfache Frage stellen: Nutzen wir unsere Freiheit in produktiver, tugendhafter Weise oder nicht? Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wir die Freiheit verwechseln mit dem Recht, alles ganz nach Lust und Laune zu tun
Lesen Sie hier den Beitrag vom Neue Zürcher Zeitung Online vom 01.10. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des NZZ Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.nzz.ch
JUDENTUM UND CHRISTENTUM
"Jesus wollte vielleicht ursprünglich gar keine neue Religion"
Der Dialog von Christen und Juden schien nach der Schoah unmöglich. Das ändert sich. Hier sprechen der Rabbiner Julian-Chaim Soussan und der katholische Theologe Joachim Valentin miteinander – über neue Fakten und einen schwierigen Papst.
Von Jan Grossarth
WELT: Herr Rabbiner Soussan, Herr Professor Valentin, wir wollen über den Dialog zwischen der jüdischen und der christlich-katholischen Gemeinde sprechen. Wo steht die Annäherung im historischen Maßstab?
Julian-Chaim Soussan: Es gibt beidseitig viele Aktivitäten. Erst im November letzten Jahres haben sich die Deutsche Bischofskonferenz und die Orthodoxe Rabbinerkonferenz in Berlin getroffen und dabei auch sehr viel über Theologie geredet – was man noch vor Jahrzehnten gerade von orthodoxer Seite streng vermeiden wollte.
Joachim Valentin: Spätestens seit der Veröffentlichung des katholischen Konzilstextes „Nostra Aetate“ 1965 stellt es sich so dar, dass sich das Christentum ohne eine gute Kenntnis des Judentums nicht verstehen lässt – aber auch nicht ohne Kenntnisse des rabbinischen nachjesuanischen Judentums, das sich parallel mit dem Christentum entwickelt hat. Wir Katholiken haben uns neu an den Paulussatz erinnert: „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich“ (Röm 11,18). Wir verstehen diese frühchristliche „jüdische Sekte“, die damals im Entstehen war, neu als aufgepfropfte Zweige auf dem Ölbaum Judentum. Das Christentum, das sich über Jahrhunderte unter Abzug des Jüdischen auf der Basis von dezidiert antijüdischen Kirchenvätern definiert hat, war ein defizientes Christentum.
WELT: Das klingt revolutionär.
Valentin: Darauf stoßen wir erst jetzt, in unserer Zeit. Die Kirche ist zum Beispiel in Fragen der Sexualmoral nicht immer in die richtige Richtung gelaufen, aber auch nicht im Umgang mit Andersgläubigen. Wenn man verstanden hätte, dass man selbst divers ist, wäre man auch anders mit Andersgläubigen umgegangen. Die Kräfte, die diese Art der historisch-kritischen Selbstreflexion nicht wollen, sind aber leider bis heute auch in der Kirche stark.
WELT: Wer ist das?
Valentin: Es sind leider sogar ganz aktuelle Texte von Joseph Ratzinger, also dem emeritierten Papst Benedikt XVI. , die diese Diversität im Eigenen infrage stellen. Papst Johannes Paul II. hingegen, dessen 100. Geburtstag wir in diesen Tagen gefeiert haben, ist dagegen in meinen Augen wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen. Ich denke an seinen Satz von 1980 im Mainzer Dommuseum vom „Gottesvolk des von Gott nie gekündigten Alten Bundes“ – der meint, dass es offenbar neben dem christlichen mindestens noch einen jüdischen Heilsweg gibt. Damals war ich als Jugendlicher auch in Mainz, ohne zu verstehen, was hier geschieht.
WELT: Ist aus Ihrer Sicht also ein Sinn des Dialogs: Wir brauchen ihn als Katholiken, um Defizite in unserem Selbstbild zu heilen?
Valentin: Ja, aber eine dialogfähige Haltung braucht es natürlich auch, damit das Miteinander der Religionen in einer Stadt wie Frankfurt gelingt. Und selbstverständlich ist sie unerlässlich nach der Schoah, die uns Katholiken und Katholikinnen gezeigt hat, wir sind vor allem Teil des Problems, nicht der Lösung.
Soussan: Fast 2000 Jahre gab es im Christentum die Idee von Substitution – dass die Kirche über Jesus den Bund Gottes mit Israel ersetzt und fortführt. Demnach seien die Juden verloren, verstoßen, vertrieben. Diese Idee ist natürlich aus jüdischer Sicht nicht haltbar. Das aber hat sich durch den Konzilstext „Nostra Aetate“ geändert. Seitdem stellt das Judentum für Katholiken eine legitime andere Sichtweise dar. Mit einem Punkt dessen, was Herr Valentin da gerade sagte, bin ich allerdings aus traditionell jüdisch-orthodoxer Sicht nicht einverstanden: dass wir nämlich zwei parallele Entwicklungen seien, die sich nach der Tempelzerstörung vollzogen haben. Aber immerhin ist das nun eine Möglichkeit, überhaupt auf Augenhöhe zu diskutieren.
WELT: Bleibt aber die Tatsache, dass das Judentum früher war und damit gewissermaßen kein so naheliegendes Interesse am Dialog mit dem Christentum hat?
Soussan: Ja, es gibt ein gewisses Gefälle: Das Judentum existiert auch ohne das Christentum. Wir definieren uns aus dem Judentum heraus. Das Christentum kommt dann hinzu.
Valentin: Das berührt eine Grundsatzfrage danach, wie ich im Dialog damit umgehe, dass es andere Gruppen gibt, die sagen, wir glauben auch an einen Gott, und er führt uns zum Heil, und alle anderen führt ihr Unglaube in die Hölle. Das erleben wir Christen genauso im christlich-islamischen oder die Juden im jüdisch-islamischen Dialog.
WELT: Welche Gefahren birgt der Dialog? Auch den Verlust religiöser Identität?
Lesen Sie hier den Beitrag vom WELT Online vom 22.09. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
MEINUNGSFREIHEIT
Cancel Culture ist das Ende der Aufklärung
Debatten müssen dazu dienen, herausfinden, was wirklich der Fall ist – unabhängig davon, wer welche Interessen hat und welchen persönlichen Hintergrund. In der Cancel Culture gilt das nicht mehr. Sie bedroht unsere Demokratie.
Von Julian Nida-Rümelin*
*
Julian Nida-Rümelin ist Physiker und Philosoph. Er lehrt seit 2004 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Kürzlich erschien sein jüngstes Buch „Die gefährdete Rationalität der Demokratie“ in der Edition der Körberstiftung 2020.
Im US-Diskurs, der zunehmend auch auf Europa übergreift, wird unter „Cancel Culture“ das Phänomen verstanden, anders meinende Positionen unter Verweis auf ihre ethische oder politische Fragwürdigkeit zu unterdrücken, Auftritte ihrer Protagonisten abzusagen, Stellungnahmen nicht zu publizieren. Cancel Culture wird meist eher links im politischen Spektrum verortet, und entsprechend kommt die Kritik nicht nur von liberal Gesinnten, sondern auch von rechts.
Generell hat sich ein Teil der rechten Propaganda zunehmend eines Vokabulars ermächtigt, das sonst eher für liberale, meist als bürgerlich wahrgenommene Milieus charakteristisch ist. Es wird die Einschränkung von Menschen- und Bürgerrechten beklagt und die freie Selbstentfaltung und Meinungsäußerung eingefordert, die von linken Ideologen bedroht würden. Diesen Klagen und Forderungen schließen sich auch Personen an, die sich identitären Bewegungen oder anderen rechten Gemeinschaften zugehörig fühlen, die gleiche Rechte und individuelle Freiheiten in anderen politischen Kontexten als nachrangig ansehen.
Die politische und mediale Welt scheint sich so in einem großen Rollentausch zu befinden. Während in früheren Zeiten linke Kritiker die vermeintlich festgefügte bürgerliche Presse dafür kritisierten, dass sie nicht gehört und ernst genommen wurden, verteidigt nun das linke und liberale Milieu die seriösen Medien gegen die Unterstellung von rechts, sie seien Teil einer System- oder gar Lügenpresse.
Die Vermutung liegt nahe, dass manche linke und liberale Milieus, zuvor eher Mainstream-kritisch, nun selbst Teil des Mainstreams geworden sind und sich nun fundamentaler Kritik zu entziehen suchen, indem die Legitimität der kritischen Äußerung selbst infrage gestellt wird. Das, worunter ihre Protagonisten früher litten, wird nun selbst zur medialen Strategie.
Aber Cancel Culture ist mehr, es ist der Übergang zu Dogmatismus und Intoleranz mit der Gefahr, die zivilkulturelle Basis der Demokratie auszuhöhlen. Es lohnt sich der genaue Blick auf das, was als Cancel Culture kritisiert und als politische Korrektheit verteidigt wird.
Tatsächlich haben wir es hier mit einem wiederkehrenden Phänomen zu tun, dessen Grundmuster bei allen zeitbedingten Besonderheiten unverändert ist. Aus einer Außenseiter- oder jedenfalls Minderheitenposition heraus wird für Pluralität und Diversität plädiert, um dem eigenen Standpunkt Gehör zu verschaffen, um dann, wenn dieser hinreichend viel Zustimmung gefunden hat, Kritik und Widerspruch klein zu halten und die Grenzen wünschenswerter Diversität immer enger um den eigenen Standpunkt zu ziehen.
Da wird debattiert, ob man einen bekannten marxistischen amerikanischen Intellektuellen als Redner wieder ausladen darf, weil er der Auffassung ist, dass die USA weniger ein Rassismus- als ein Klassenproblem hätten und die Hautfarbe erst durch kapitalistische Abhängigkeitsverhältnisse relevant werde. Da gibt es eine distanzierte Kabarettistin , die rassistische und antisemitische Klischees in einer Weise karikiert, die die schlichteren Geister unter ihren Zuhörern selbst als rassistisch oder antisemitisch empfinden. Unter der Oberfläche dieser Debatte verbergen sich grundlegendere Fragen, die an unser demokratisches, ja unser menschliches Selbstverständnis rühren.
John Rawls , der große Gerechtigkeitstheoretiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hatte für Religionsfreiheit folgendes Argument entwickelt:
Über Gerechtigkeitsprinzipien muss aus einer Situation entschieden werden, die Fairness garantiert.
Lesen Sie hier den Beitrag vom WELT Online vom 21.09. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
DER FALL DIETER NUHR
Wehe, du trittst dem Meinungskartell entgegen
Über Dieter Nuhr regen sich Leute auf, die sich für ihre eigenen Irrtümer nicht interessieren. Werden wieder Menschen im Stich gelassen wie im Mittelalter - und von wem geht die Intoleranz aus? Das fragt sich unser Gastautor.
Von Peter Schneider*
*Der Autor ist ein deutscher Schriftsteller. In den 1960er-Jahren war er einer der Wortführer der Studentenbewegung in Berlin. Zuletzt erschien von ihm „Denken mit dem eigenen Kopf“ (Kiepenheuer&Witsch).
Es steht nicht gut um das liebste Kind der Aufklärung, um die Meinungsfreiheit. Ich rede nicht von deren Abschaffung in Russland, in der Türkei, in China. Dort wird der Wählerwille bekanntlich nicht mit den Mitteln des offenen Meinungsstreits „ermittelt“, sondern mithilfe von gelenkten Medien, grotesken Verfassungsänderungen, technisch optimierten Überwachungssystemen, notfalls auch mit den klassischen Instrumenten der Wahlfälschung und/oder mit der Verhaftung und Ermordung oppositioneller Führer. Man fragt sich, warum die Macho-Autokraten dieser Welt einen derartigen Aufwand treiben, um sich den Anschein demokratischer Legitimation zu verschaffen. Könnten sie nicht einfach sagen: Wir haben doch sowieso die Macht und sparen uns den ganzen Zirkus?
Offenbar ist das Versprechen der Demokratie so populär geworden, dass die Autokraten ihm lieber einen Wahltag lang Reverenz erweisen. Was man doch in aller Bescheidenheit einen Erfolg dieses Versprechens nennen kann.
Aber ich rede hier von der Bedrohung des freien Meinungsaustauschs in den Ursprungsländern der Aufklärung, in Europa und den USA – und zwar durch die Bürger selber. Der Vorteil freier Gesellschaften besteht prinzipiell in ihrer Fähigkeit, gesellschaftliche Fehlentwicklungen benennen zu können, um sie dann zu korrigieren – zugegeben ein Vorteil, den diese Gesellschaften allzu selten wahrnehmen.
Diese Fähigkeit wird jedoch in ihrem Kern beschädigt, wenn der Meinungsstreit in einen verbalen Vernichtungskampf ausartet, der mit unflätigen Beleidigungen und dem Mittel der persönlichen Diskreditierung ausgetragen wird – ein Sport, für den die amerikanische Sprache den Ausdruck „character assassination“ bereithält, zu deutsch: moralische Vernichtung.
Da war eine ehrwürdige staatliche Institution namens Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) auf die Idee gekommen, den Kabarettisten Dieter Nuhr aus Anlass ihres hundertjährigen Bestehens um einem Podcast von dreißig Sekunden zu bitten. Der tat ihr den Gefallen: Wissen bedeute nicht, dass man sich zu 100 Prozent sicher sei, sondern dass man über genügend Fakten verfüge, um eine begründete Meinung zu haben. Wissenschaft bedeute gerade, „dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert“. Wer ständig rufe „Folgt der Wissenschaft!“, habe dieses Wesensmerkmal nicht begriffen. „Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben.“
Dieter Nuhr war nie ein Kind von Traurigkeit. Er hat es zu seinem Beruf gemacht, die Sitzfestigkeit des jeweils aktuellen ideologischen Mobiliars zu prüfen, auf dem es sich andere allzu rasch bequem machen, und nimmt dabei in Kauf, dass er sich Feinde bei allen Möbelherstellern macht.
Ob er nun die Gewissheiten der Salafisten, der Umweltschützer, des Gendersprechs und der Umbenenner aufs Korn nimmt – einen Vorwurf kann man Nuhr nicht machen: dass er seine Spitzen einseitig verteile. Das ist vielleicht das größte Ärgernis an dem Mann mit dem gedehnten Nur-Anspruch seiner Einwürfe:
Man kann ihn keinem Lager zuordnen.
Lesen Sie hier den Beitrag vom WELT Online vom 10.08. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
VERSCHWÖRUNGSMYTHEN
„Das Böse in uns selbst"
Verschwörungsmythen erfahren in der Coronakrise offenbar besonders großen Zuspruch. Im Grunde seien alle Menschen dafür anfällig, sagte der Religionswissenschaftler Michael Blume im Dlf, auch Bildung schütze nicht. Lernen könne man hingegen vom Judentum.
Michael Blume im Gespräch mit Christian Röther
Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Beauftragter der Landesregierung von Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Seit einigen Jahren befasst er sich auch mit Verschwörungsmythen und betreibt dazu den Podcast „Verschwörungsfragen“.
Christian Röther: Herr Blume, Sie sprechen von Verschwörungsmythen, nicht von Verschwörungstheorien. Warum?
Michael Blume: Theorien sind wissenschaftliche Erklärungen. Und der Begriff „Verschwörungstheorien“, der taucht im 18., 19. Jahrhundert auf und wird dann von Karl Popper geprägt, der genau davor warnt, dass eben Verschwörungstheorien keine wissenschaftlichen Theorien wären. Aber leider ist es heute so, dass sogar der Verschwörungsmythos unterwegs ist, der Begriff „Verschwörungstheorie“, den habe der CIA entwickelt, um die Leute nach der Ermordung von John F. Kennedy zu unterdrücken.
Ich sage ganz klar: Es sind keine Theorien. Wer „Verschwörungstheorien“ sagt, der geht den Leuten schon auf den Leim und denkt, man diskutiert über Wissenschaft. Ich plädiere deswegen dafür, ganz klar von Verschwörungsmythen zu sprechen.
„Gute und schlechte Mythen“
Röther: Mit dem Begriff haben Sie auch mich überzeugt. Ich spreche auch nur noch von Verschwörungsmythen und nicht mehr von Theorien. Allerdings bin ich auch ein bisschen ins Zweifeln gekommen, ob das der richtige Begriff ist. Weil Mythen, Mythos – das ist für mich vor allem positiv konnotiert. Wertet man diesen Verschwörungsquatsch nicht auf, wenn man ihn „Mythen“ nennt?
Blume: Tatsächlich glaube ich, das ist so ein bisschen das Kernproblem, dass wir nämlich eigentlich denken: Denken ist etwas Positives, Glauben ist etwas Positives, Mythos ist etwas Positives. Und dann völlig verwirrt sind, wenn Menschen Böses denken, wenn sie an das Böse glauben, oder eben schwurbeln, also zum Beispiel alles, was auf der Welt geschieht, auf eine vermeintliche Verschwörung zurückführen. „Gib Gates keine Chance“ ist ja so ein aktuell verbreitetes Muster dafür.
Und das ist, glaube ich, genau das Problem: Wir müssen uns leider klarmachen, dass wir Menschen zwar dazu geboren sind, zu glauben und zu denken, aber wir können auch daran glauben, dass böse Mächte die Welt beherrschen. Und wir können uns auch in Rassismus, Antisemitismus oder Frauenfeindlichkeit hineindenken. Und deswegen müssen wir auch beginnen, gute und schlechte Mythen zu unterscheiden, und da auch kritischer werden. Auch gegenüber dem, was wir selber glauben und zu wissen meinen.
„Eine umgedrehte Religion“
Röther: Mythen, die spielen ja auch in Religionen wichtige Rollen. Mit Religion ist dieser Begriff „Mythos“ eigentlich am engsten verschränkt. Wenn jetzt Religionen und Verschwörungen beide auf Mythen basieren, was sind die dann? Sie haben das gerade auch schon angedeutet: Die sind irgendwie verwandt.
Lesen Sie hier den Beitrag aus DEUTSCHLANDFUNK vom 04.08. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des DEUTSCHLANDFUNK. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.deutschlandfunk.de
PHILOSOPH MARKUS GABRIEL ÜBER MORAL HEUTE
„Das Böse nimmt spürbar zu"
Propaganda, Ideologie, Fake News und Halbwahrheiten verdeckten heute, was der Mensch tun oder unterlassen soll, diagnostiziert der Philosoph Markus Gabriel. Es seien dunkle Zeiten. Dabei könne nur die Moral uns vor dem Abgrund retten.
Markus Gabriel zählt zu den bekanntesten deutschen Gegenwartsphilosophen. Mit 28 war er Professor in New York. Seit er 29 ist, hat er an der Uni Bonn den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegenwart inne. Seine Bücher waren Bestseller und jetzt gibt es ein neues Werk von ihm: „Moral in dunklen Zeiten“.
Liane von Billerbeck: Herr Gabriel, leben wir denn in dunklen Zeiten?
Gabriel: Und ob, muss man leider sagen. Dunkle Zeiten sind Zeiten, in denen das, was wir aus moralischen – also alle Menschen betreffenden – Gründen tun beziehungsweise unterlassen sollen, durch Propaganda, Ideologie, Fake News, Halbwahrheiten und so weiter verdeckt wird. Und je mehr solche Verdeckungsstrategien wir haben, desto dunkler die Zeiten.
Billerbeck: Das heißt Finanzkrise, Werteverfall, Krise der liberalen Demokratie, Klimawandel, Populismus, all das. Was ist die größte dieser Bedrohungen, wenn Sie die gegeneinander abwägen?
Gabriel: Die größten Bedrohungen kommen zum einen aus der Klimakatastrophe. Das ist eine echte existenzielle Gefahr, wie man das in der Philosophie heute nennt – kurzum die Selbstzerstörung der Menschheit.
Und zum anderen aus einer nicht wünschenswert organisierten Digitalisierung, also einer unethischen Digitalisierung, die gerade ebenfalls den Planeten verwüstet – durch die Selbstzerstörung der liberalen Demokratie.
Das halte ich für die derzeit gefährlichsten Katastrophen, die leider auch noch eng miteinander verzahnt sind.
Das Gute wird immer öfter in Frage gestellt
Billerbeck: Warum geht mit dieser Entwicklung die, wie Sie es in Ihrem Buch beschrieben haben, Verdunklung des moralischen Horizonts einher?
Gabriel: Der moralische Horizont besteht darin, dass wir sehen, was wir aus teils ganz offensichtlichen Gründen tun beziehungsweise unterlassen sollen: Sehr wenige von uns schubsen zum Beispiel Menschen die U-Bahn runter. Und zu Recht sind wir empört, wenn wir hören, dass das mal wieder in München oder Berlin stattgefunden hat. Das heißt, wir tun sehr häufig das moralisch offensichtlich Gute und vermeiden das Böse.
Lesen Sie hier den Beitrag aus DEUTSCHLANDFUNK vom 04.08. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des DEUTSCHLANDFUNK. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.deutschlandfunk.de
DER BUCHTIP
Diese Wahrheiten
Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika
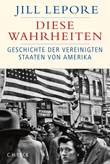
- Aus der Einleitung
"Die Amerikaner stammen von Eroberern und Eroberten ab, von Menschen die als Sklaven gehalten wurden, und von Menschen die Sklaven hielten, von der Union und von der Konföderation, von Protestanten und von Juden, von Muslimen und von Katholiken, von Einwanderern und von Menschen, die dafür gekämpft haben, die Einwanderung zu beenden. In der amerikanischen Geschichte ist manchmal - wie in fast allen Nationalgeschichten - der Schurke des einen der Held des anderen. Aber dieses Argument bezieht sich auf die Fragen der Ideologie: Die Vereinigten Staaten sind auf Basis eines Grundbestands von Ideen und Vorstellungen gegründet worden, aber die Amerikaner sind inzwischen so gespalten, dass sie sich nicht mehr darin einig sind, wenn sie es denn jemals waren, welche Ideen und Vorstellungen das sind und waren."
In einer Prosa von funkelnder Schönheit erzählt die preisgekrönte Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Sie schildert sie im Spiegel jener «Wahrheiten» (Thomas Jefferson), auf deren Fundament die Nation gegründet wurde:
- der Ideen von der Gleichheit aller Menschen,
- ihren naturgegebenen Rechten und
- der Volkssouveränität.
Meisterhaft verknüpft sie dabei das widersprüchliche Ringen um den richtigen Weg Amerikas mit den Menschen, die seine Geschichte gestaltet oder durchlitten haben. Sklaverei und Rassendiskriminierung kommen ebenso zur Sprache wie der Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen oder die wachsende Bedeutung der Medien. Jill Lepores große Gesamtdarstellung ist aufregend modern und direkt, eine Geschichte der politischen Kultur, die neue Wege beschreitet und das historische Geschehen geradezu hautnah lebendig werden lässt.
Eine Leseprobe aus der Einleitung:
Die Frage stellen
DER LAUF DER GESCHICHTE ist nicht vorhersehbar, er ist so unregelmäßig wie das Wetter, so wechselhaft wie Empfindungen. Nationen erstarken und fallen durch Laune und Zufall, heimgesucht von Gewalt, korrumpiert von Gier, erobert von Tyrannen, überfallen von Schurken, verwirrt von Demagogen. Dies alles traf zu, bis die Leserschaft einer Zeitung namens New-York Packet eines Tages, am Dienstag, dem 30. Oktober 1787, auf der Titelseite des Blattes eine Anzeige für einen Almanach vorfand, der Tabellen mit Angaben zum «Aufgang und Untergang der Sonne», zur «Beurteilung des Wetters», zur «Länge von Tagen und Nächten» und als Zugabe etwas vollkommen Neues enthielt: die Verfassung der Vereinigten Staaten, 4400 Wörter, die das Handeln der verschiedenen Abteilungen des Regierungssystems und die Teilung seiner Gewalten dar-zustellen versuchten, als ob es sich dabei um Fragen der Physik wie den Durchgang des Mondes vor der Sonne oder den Wechsel der Gezeiten handelte.1
Dies sollte den Beginn einer neuen Ära anzeigen, in welcher der Lauf der Geschichte vielleicht vorhersagbar gemacht und ein Regierungssystem geschaffen werden könnte, das nicht durch Zufall und Gewalt, sondern durch Vernunft und freie Entscheidung gelenkt werden würde. Die Ursprünge dieses Gedankens und sein Schicksal machen die amerikanische Geschichte aus. Die Verfassung war mit mühseliger Arbeit und langen Auseinandersetzungen verbunden. Den ganzen Sommer über waren die Delegierten des Verfassungskonvents, in Kniebundhosen und ständig durchgeschwitzt, bei drückender Hitze und größter Geheimhaltung in Philadelphia zusammengekommen, die Fenster ihrer Versammlungshalle hatte man zum Schutz gegen Lauscher zugenagelt.
Bis Mitte September hatten sie einen auf vier Seiten Pergament festgehaltenen Entwurf fertiggestellt. Sie gaben diesen Entwurf an Drucker weiter, die den Text seiner hochfliegenden Präambel setzten, beginnend mit einem riesigen W, das so scharf wie eine Vogelkralle daherkam:
- Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen,
- Gerechtigkeit zu verwirklichen,
- die Ruhe im Innern zu sichern,
- für die gemeinsame Verteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und
- die Segnungen der Freiheit für uns und unsere Nachkommen zu bewahren,
setzen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika in Kraft.

Jill Lepore ist Professorin für amerikanische Geschichte an der Harvard Universität und Staff writer des Magazins "The New Yorker". Sie hat mehr als ein halbes Dutzend Preise für ihre Bücher erhalten und war Finalistin für den National Book Award und den Pulitzer-Preis. Ihr Opus magnum "Diese Wahrheiten" stand wochenlang auf den amerikanischen Bestsellerlisten.
© Foto: The New York Times / Redux / laif
Lepore, Jill, Diese Wahrheiten - Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika Die Sachbuch-Bestenliste für Dezember: Platz 9, Verlag C.H.Beck, München, ISBN 978-3-406-73988-0, Erschienen am 15. Oktober 2019. 5. Auflage, 2020, 1120 S., mit 33 Abbildungen, Leinen. Preis: Hardcover 39,95 €, e-Book 30,99 €
„DEN BOGEN ÜBERSPANNT“
Vatikan empört deutsche Katholiken
Die katholische Kirche hat kaum noch Priester. Deshalb übernehmen immer mehr Nicht-Kleriker Leitungsfunktionen. Doch jetzt sagt der Papst: So geht's nicht. Und nun?
Von Christoph Driessen, dpa
Wenn in Rom im Hochsommer der Asphalt dampft, die Luft flirrt und die Konturen verschwimmen, dann kommt das Leben in der Ewigen Stadt teils zum Erliegen. Für den Vatikan scheint das allerdings nicht zu gelten, denn der schreckt seine Schäfchen mitten in der Ferienzeit auf – mit einer Instruktion, die sogar unter Bischöfen auf offene Ablehnung stößt.
Das Schreiben der Kleruskongregation des Vatikans trägt den einschläfernden Titel "Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche". Der darunter folgende Text hat in etwa die Lebendigkeit eines Telefonbuchs mit Fußnoten. Dennoch ist er für viele Katholiken eine Provokation, ja ein Skandal. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (Zdk), Thomas Sternberg, bescheinigt dem Papier eine "abenteuerliche Realitätsferne".
Die Zahl der Priester schrumpft und schrumpft
Worum geht es? Zurzeit gibt es in ganz Deutschland 13.000 Priester, vor 30 Jahren waren es noch 20.000. Im ganzen vergangenen Jahr wurden nur 63 Männer neu zu Priestern geweiht – bei immerhin noch 22,6 Millionen Katholiken. Jedes Jahr wird in den Kirchen neu um mehr Priesternachwuchs gebetet – ohne Erfolg. Es herrscht totale Unterversorgung.
Die Bistümer mussten zwangsläufig darauf reagieren. Sie haben immer mehr Pfarreien zu Großgemeinden zusammengelegt. An deren Spitze steht dann oft nur noch ein Team von zwei oder drei Priestern. Natürlich können die nicht die ganze Arbeit allein bewältigen. Viele ihrer früheren Funktionen werden deshalb mittlerweile von bezahlten Mitarbeitern – zum Beispiel Gemeindereferenten oder -referentinnen – oder von Ehrenamtlichen ausgeübt.
In der Gemeinde St. Barbara in Duisburg zum Beispiel machen die Ehrenamtlichen alles selber. Sonntags kommt ein Priester aus einem anderen Stadtteil vorbei und zelebriert eine Messe – das wars aber auch schon: "Alle übrigen Gottesdienste, Andachten und Gebetszeiten werden von ehrenamtlichen Laien geleitet", heißt es auf der Website.
Ehrenamtliche haben nicht die gleiche Verbindung zu Gott
Das aber – so stellt der Vatikan nun in seiner von Papst Franziskus ausdrücklich abgesegneten Instruktion klar – ist so in der katholischen Kirche nicht vorgesehen. Pfarreien können demnach nur in begründeten Ausnahmefällen aufgehoben oder verschmolzen werden – und Priestermangel ist laut Vatikan generell kein akzeptabler Grund dafür.
Lesen Sie hier den Beitrag aus T-Online vom 25. 07. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des T-Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.t-online.de
EUROPA OHNE AMERIKA
Wenn die USA nicht mehr Weltmacht sein wollen
Im globalen Monopoly müssen die Europäer wieder zurück auf Platz zero. Aber anders als im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg könnten sie bald ohne die militärische und moralische Absicherung durch Amerika dastehen.
Von Michael Stürmer
Ob es im Verhältnis zu den USA nicht Zeit sei für eine strategische Autonomie der EU, wurde die Bundeskanzlerin jüngst in einem Interview gefragt. Es gebe überragende Gründe, weiter auf eine transatlantische Verteidigungsgemeinschaft zu setzen, antwortete Angela Merkel, und ergänzte: „Wir sind aufgewachsen in der Gewissheit, dass die USA Weltmacht sein wollen. Wenn sich die USA nun aus freiem Willen aus der Rolle verabschieden sollten, müssten wir sehr grundsätzlich nachdenken.“
Es war eine Vision, die Merkel schon im Sommer 2017 angedeutet hatte bei ihrer Rede im Bierzelt von Trudering . Sie wurde in Staatskanzleien weltweit gehört und erzeugte viel Rätselraten, bis heute. Auf die alten Freunde sei kein Verlass mehr, sagte sie damals, es sei an der Zeit für neue Antworten.
Wenn in öffentlicher Rede die deutsche Bundeskanzlerin, als mächtigste Frau der Welt gerühmt, in strategischen Alternativen laut zu denken anfängt, dann reichen wenige Worte für viel Zweifel. Es war staatsklug, solche Andeutungen nicht auszubuchstabieren. Das deutsche Publikum gab sich zufrieden, nicht aber der Rest der Welt. Dafür ist das Potenzial an deutschen Sonderwegen, vergangenen und künftigen, zu groß.
Hat die deutsche Bundeskanzlerin, Visionen und Spekulationen grundsätzlich abhold, eine andere Idee von Europa? Von den Vereinigten Staaten im Zeichen des Trumpismus? Von Russland in Zeiten der Verbitterung? Oder von China, das wieder Reich der Mitte sein will
Wie über Nacht ist die alte Deutsche Frage wieder ins Zentrum des Systems gerückt: Wohin gehört Deutschland, wohin gehören die Deutschen? Eines ist jedenfalls gewiss: Die Antwort hat den Deutschen nie allein gehört – dafür war Deutschland, unter welchem Namen auch immer, zu groß oder zu klein, zu viel geteilt oder zu wenig.
Der Zwei-plus-vier-Vertrag, Meisterwerk der Diplomatie, gründete 1990 ein neues europäisches Gleichgewicht und beendete den Kalten Krieg in seinem europäischen Zentrum. Aber er hatte Voraussetzungen und Folgen, die jetzt deutlicher sichtbar werden. Jene Sicherheitsarchitektur von Vancouver bis Wladiwostok, die damals möglich erschien, ist Trugbild geblieben.
Unausgesprochene Angst geht um, dass der Friede von 1990 nicht der Geschichte letztes Wort ist, sondern auf geschichtlichen Voraussetzungen beruhte, die jetzt im Schwinden sind.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 26. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
BUCHTIP
Religion im US-Wahlkampf
Zerlegen sich die USA und ihre Ideale seit Jahren selbst? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht mehr das , was wir hier in Europa insbesondere und auch in der ganzem Welt ebenso seit dem 2. Weltkrieg, kennengelernt hatten und nur noch in Erinnerung kennen. Die USA haben sich immer als „God‘s own country“ gesehen und verstanden. Welche Rolle spielt nun die Religiösität in diesem einst von Protestanten gegründeten jedoch inzwischen entscheidend römisch-katholisch geprägten Land und was könnte das für den Rest der Welt bedeuten?.
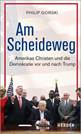
Christentum und Demokratie – für den größten Teil der amerikanischen Geschichte handelte es sich hierbei um eine komplementäre Beziehung. Doch die Wahl von Donald Trump und die Rolle, die Evangelikale darin gespielt haben, legt nahe, dass sich beider Wege nun trennen. Wie und warum es dazu kam, zeigt dieses Buch. Es schildert, wie der amerikanische Protestantismus zunehmend in eine autoritäre Richtung abgedriftet ist. Ausschlaggebend hierfür ist die Überzeugung, die Kulturkämpfe der letzten Jahrzehnte verloren zu haben. Die Evangelikalen betrachten sich selbst als am stärksten verfolgte Gruppe in den USA und halten Ausschau nach einem starken Beschützer, der sie gleichsam aus dem Babylonischen Exils herausführt und ihnen ihr Land zurückgibt. Dieses Gefühl von Verlust und Anspruch ist tief im Narrativ von Amerika als weißer christlicher Nation verwurzelt. Trump hat die Herzen der Evangelikalen hier gepackt, indem er mit ihren tiefsten Ängsten spielt. Amerikas Christentum und die Demokratie am Scheideweg: Wird es gelingen, beide wieder in zusammenzuführen?

Philip Gorski, PhD in Soziologie an der University of California, Berkeley, ist Professor für Soziologie an der Yale University. Er ist Schüler des prominenten Soziologen Robert N. Bellah und einer der führenden jüngeren amerikanischen Religionssoziologen.
Philip Gorski, Am Scheideweg - Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump, Verlag Herder, 1. Auflage 2020, 224 Seiten, ISBN: 978-3-451-38890-3,Bestellnummer (Verlag: www.herder.de): P388900, Gebundene Ausgabe, 24,00 € inkl. MwSt.,Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
NUR 57 WEIHEN IM JAHR
Katholischer Kirche gehen die Priester aus
Rund ein Viertel aller Deutschen sind Mitglied in der katholischen Kirche - Tendenz sinkend. Doch nicht nur die Gemeinden schrumpfen. Einem Bericht zufolge wird es in diesem Jahr nur sehr wenige Priesterweihen geben. Und so gibt es einmal mehr laute Überlegungen über Frauen hinter dem Altar.
In diesem Jahr gibt es einem Zeitungsbericht zufolge erneut nur sehr wenige katholische Priesterweihen in Deutschland. In allen 27 Bistümern würden 2020 insgesamt nur 57 Männer zum Priester geweiht, meldet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf eine eigene Erhebung. Dem Blatt zufolge ist dies die zweitniedrigste Zahl in der Geschichte der Bundesrepublik, nachdem es den bislang tiefsten Stand 2019 mit 55 katholischen Neupriesterweihen gegeben habe.
In den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl damit um 64 Prozent zurückgegangen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zeigte sich alarmiert. "Im vergangenen Jahr kam auf elf ausscheidende Priester eine Neuweihe - wenn man das weiter rechnet, sieht man, in welche Katastrophe das münden wird", sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg der Zeitung. "Wir bräuchten 200 oder 300 Priesterneuweihen jedes Jahr - doch davon sind wir ganz weit entfernt."
Sternberg forderte, das Priesteramt auch für Frauen und verheiratete Männer zu öffnen. "Wir brauchen (...) auf Dauer auch das Frauenpriestertum, und der Beruf selbst muss wieder attraktiver werden", sagte er dem Blatt. Indes treten auch immer mehr Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche aus.
Vergangenes Jahr waren es bei den Katholiken 272.771 Austritte - 26 Prozent mehr als 2018 und die bisher höchste Zahl überhaupt. Insgesamt gibt es in Deutschland noch 22,6 Millionen Katholiken, hatte die Deutsche Bischofskonferenz Ende Juni in Bonn mitgeteilt.
Auch die evangelische Kirche leidet unter Mitgliederschwund.
Lesen Sie hier den Beitrag aus n-tv Online vom 10.07. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des n-tv Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.n-tv.de
NETZWELT
Reporter ohne Grenzen warnt vor möglicher Überwachung ausländischer Blogger
In wenigen Wochen könnte ein Entwurf für das neue BND-Gesetz vorliegen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert nun, dass damit nicht nur klassische Journalisten, sondern auch Blogger geschützt werden. Gerade in autoritären Regimen können Bürgerjournalisten entscheidend sein.
Lesen Sie hier den Beitrag aus SPIEGEL Online vom 09.07. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.spiegel.de
DEUTSCHLAND
Kirchen beklagen Rekordzahl an Austritten
Die Zahlen seien nicht schönzureden: Mehr als 800.000 Mitglieder verloren die evangelische und katholische Kirche im Jahr 2019 – über eine halbe Million Menschen, so viele wie nie zuvor, traten aus der Kirche aus. Bei den Katholiken sinkt auch die Zahl der Taufen.
Der Mitgliederschwund in der evangelischen und katholischen Kirche beschleunigt sich. Mehr als 800.000 Mitglieder verloren die beiden großen christlichen Kirchen im vergangenen Jahr. Das zeigen die Mitgliederstatistiken der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für 2019, die am Freitag veröffentlicht wurden. 2018 war es in der Summe ein Verlust von 704.000 Mitgliedern. Doch immer noch gehört mehr als jeder zweite Deutsche einer dieser beiden christlichen Konfessionen an.
An diesen Zahlen sei nichts schönzureden, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Ihn wie auch seinen Amtskollegen, den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm , schmerzt vor allem die hohe Zahl der Kirchenaustritte. Sie sind neben den Sterbefällen der Grund für den Mitgliederschwund. Mehr als eine halbe Million Menschen, so viele wie nie zuvor, verließen im Jahr 2019 die Kirche.
Auf Basis der gemeldeten vorläufigen Zahlen aus den 20 evangelischen Landeskirchen traten etwa 270.000 Menschen aus der Kirche aus. Das sind rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte die EKD mit. 2014 hatte die Zahl der Austritte schon einmal bei rund 270.000 gelegen. Wie schon 2018 verstarben auch 2019 rund 340.000 Kirchenmitglieder. Die EKD kündigte an, die erhöhten Austrittszahlen vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD untersuchen lassen zu wollen.
Mehr Menschen traten aus der katholischen Kirche aus
Noch mehr Menschen traten 2019 aus der katholischen Kirche aus: Mehr als 272.700 annullierten ihre Mitgliedschaft – ein Anstieg von 26,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Austrittsrate stieg auf über 1,2 Prozent. So hoch war sie noch nie, sagte der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack dem Evangelischen Pressedienst (epd). Erstmals seit dem Jahr 2010, in dem der Missbrauchsskandal bekannt wurde, gab es wieder mehr Kirchenaustritte bei den Katholiken als bei den Protestanten.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 26. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
LOYALE UNTERSTÜTZER DES US-PRÄSIDENTEN
Entscheiden Deutsch-Amerikaner die Wahl für Trump?
Rund 43 Millionen Menschen deutscher Abstammung leben in den USA. Vor vier Jahren stimmten sie mehrheitlich für Trump. Das hatte auch psychologische Gründe.
Von Malte Lehming
Also proklamierte Donald Trump, Anfang Oktober 2019: Der Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren sei ein „Triumph der Freiheit“ gewesen. Das Ereignis unterstreiche, wie sehr sich die USA und Deutschland für Rechtsstaat und Menschenrechte einsetzten. „Unsere gemeinsamen Werte und historischen und kulturellen Bindungen stärken den ewigen Bund zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Diese Partnerschaft bildet das Fundament einer großen und hoffnungsvollen Zukunft für die Welt.“
Nanu? Es war derselbe Trump, der sonst keine Gelegenheit auslässt, über Deutschland herzuziehen. Über zu geringe Verteidigungsausgaben, die Ostseepipeline Nord Stream 2, Handelsdefizite, Flüchtlingspolitik, den Einfluss von Huawei. Doch an diesem Tag war all das, wenn nicht vergessen, so doch verdrängt.
Denn an diesem Tag rief der US-Präsident rief die Amerikaner dazu auf, den German-American-Day zu feiern. Ende des 17. Jahrhunderts waren die ersten Familien aus Deutschland eingewandert. Im Jahre 1883 hatte der „German Day“ seine Premiere in Philadelphia. Hundert Jahre danach erklärte US-Präsident Ronald Reagan den 6. Oktober als German-American-Day zu einem Feiertag.
Das klingt nach Folklore, hat aber einen triftigen wahlstrategischen Hintergrund. Fast alle Wählergruppen in den USA werden erforscht. Zu welcher Partei tendiert die verheiratete, weiße Frau ohne Universitätsabschluss? Worin unterscheiden sich die Cuban-Americans von den Mexican-Americans? Müssen Präsidentschaftskandidaten noch um die Stimmen der Irischstämmigen buhlen? Jede noch so kleine Nuance ist den Demoskopen wichtig.
Sie wohnen in den so genannten Swing States
Nur eine Gruppe, die durchaus wahlentscheidend sein kann, befindet sich außerhalb des öffentlichen Umfrageradars. Dabei ist sie, gemessen am Abstammungskriterium, die größte. Viele ihrer Mitglieder wohnen in den so genannten Swing States – Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida. Es sind die German-Americans, die Deutsch-Amerikaner.
Lesen Sie hier den Beitrag aus TAGESSPIEGEL Online vom 23. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des TAGESSPIEGEL Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.tagesspiegel.de
DER AKTUELLE KLASSIKER
Guten Tag, wir möchten mit Ihnen über die Bibel reden
Donald Trump lässt sich mit ihr fotografieren, Putin baut neue eine Kathedrale. Die Bibel ist immer noch ein Buch, mit dem man Politik machen kann. Aber auch Europas Kultur und Sprachen sind ohne sie nicht zu verstehen.
Von Matthias Heine
Diesem Buch, dessen jüngster Text, die Johannes-Apokalypse, vor 1900 Jahren geschrieben wurde, wird von Politikern nach wie vor eine mächtige Wirkung zugetraut – egal ob in den USA, in Russland oder China.
Donald Trump, der offenbar noch nicht mal eine eigene Bibel besitzt („Ist das Ihre Bibel?“, fragen ihn Journalisten. Trump: „Es ist eine Bibel“), ließ sich mit dem Klassiker vor einer Kirche in Washington fotografieren, die von der Antifa angezündet worden war. Einig sind sich die beiden ungläubigen Parteien, die sich in diesem Mini-Armageddeon gegenüberstanden, dass sie eine Botschaft an bibeltreue Amerikaner senden wollten. Die Antifa: Wir hassen euch und euren Gott. Der Präsident: Ich bin vielleicht kein Heiliger, aber ich kämpfe für euch.
Chinas Angst vor der Bibel
Auch Putin in Russland gründet seine Herrschaftsideologie auf die Bibel. Unter ihm wird das Christentum staatlich massiv gefördert. Gerade ist in Moskau eine neue riesige Militärkirche namens „Kirche des Sieges“ eingeweiht worden. Putin selbst und sein treuer Gefolgsmann Medwedew haben sich im Nachhinein eine lange bibeltreue biografische Tradition herbeifrisiert: Putin behauptet, er sei schon 1952 heimlich getauft worden, Medwedew berichtet, er sei mit 23 (1988, als das risikolos war) vom Atheisten zum Gläubigen geworden.
In vielen muslimischen Ländern ist die Bibel verboten, als könnte schon allein das Wort Jesu Christi den muslimischen Glauben und die darauf beruhenden Staaten ins Wanken bringen. Auch Chinas KP hat gerade wieder 48 Kirchen schließen lassen. Begründung: zu viel Bibel, zu wenig Patriotismus.
Dabei kann man die Bibel durchaus im Sinne eines engstirnigen Nationalismus auslegen – wie nicht nur Trump, Putin und Bolsonaro beweisen, sondern auch der Spruch „Gott mit uns“, der von Preußen bis zur Nazizeit auf den Gürtelschnallen deutscher Uniformen stand.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 15. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
_______________________________________________________________________
GESCHICHTE: „DIE GROSSE HURE“
Weinten die Juden wirklich an den Wassern von Babylon?
Nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier 587 v. Chr. wurden viele Juden nach Mesopotamien deportiert. Dort sollen sie sich nach Zion verzehrt haben, heißt es in der Bibel. Das Gegenteil war wohl der Fall.
Von Berthold Seewald
Die Weltstadt Babylon hat keinen guten Ruf in der Bibel. Als „Hure, die an vielen Wassern sitzt“, wird „das große Babylon“ in der neutestamentlichen „Offenbarung“ des Johannes beschrieben, als „die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden“. Als der Text Ende des ersten Jahrhunderts entstand, war Babylon allerdings eine Chiffre für „die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden“, also Rom.
Doch in einem Buch des Alten Testaments ist mit Babylon wirklich die große Stadt am Euphrat gemeint: „Babel, die Verwüsterin“, heißt es im 137. Psalm, der mit einer höchst unchristlichen Verwünschung endet: „Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert.“
Dass Babel zum Inbegriff alles Bösen in der Bibel werden konnte, hat mit zwei Feldzügen zu tun, die der babylonische Großkönig Nebukadnezar II. 597 und 587 v. Chr. gegen Jerusalem führte. Damals wurden zahlreiche Juden, vor allem Angehörige der Elite, nach Mesopotamien verschleppt, wo sie „an den Wassern von Babylon saßen und weinten, wenn wir an Zion gedachten“, so der berühmte erste Satz von Psalm 137 , der Komponisten und Interpreten von Heinrich Schütz bis Boney M. inspiriert hat.
Aber war das Leben im Herzland des babylonischen Großreichs wirklich so entsetzlich, wie die biblischen Zeugnisse vermuten lassen?
Neue Funde weisen in eine andere Richtung. Aufgrund der Analyse
neuedierter Urkunden, die in Jahudu unweit von Babylon entdeckt wurden,
kommt der Dresdner Theologe Ulfrid Kleinert jetzt in der Zeitschrift „Antike Welt “ zu einem anderen Schluss: „Die Keilschrifttexte von Jahudu zeigen, dass die Bewohner des Orts Wert auf ihre Herkunft legten, sich aber zugleich in ihrer neuen Heimat zu Hause fühlten.“
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 02. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
DER AKTUELLE KLASSIKER
Guten Tag, wir möchten mit Ihnen über die Bibel reden
Donald Trump lässt sich mit ihr fotografieren, Putin baut neue eine Kathedrale. Die Bibel ist immer noch ein Buch, mit dem man Politik machen kann. Aber auch Europas Kultur und Sprachen sind ohne sie nicht zu verstehen.
Von Matthias Heine
Diesem Buch, dessen jüngster Text, die Johannes-Apokalypse, vor 1900 Jahren geschrieben wurde, wird von Politikern nach wie vor eine mächtige Wirkung zugetraut – egal ob in den USA, in Russland oder China.
Donald Trump, der offenbar noch nicht mal eine eigene Bibel besitzt („Ist das Ihre Bibel?“, fragen ihn Journalisten. Trump: „Es ist eine Bibel“), ließ sich mit dem Klassiker vor einer Kirche in Washington fotografieren, die von der Antifa angezündet worden war. Einig sind sich die beiden ungläubigen Parteien, die sich in diesem Mini-Armageddeon gegenüberstanden, dass sie eine Botschaft an bibeltreue Amerikaner senden wollten. Die Antifa: Wir hassen euch und euren Gott. Der Präsident: Ich bin vielleicht kein Heiliger, aber ich kämpfe für euch.
Chinas Angst vor der Bibel
Auch Putin in Russland gründet seine Herrschaftsideologie auf die Bibel. Unter ihm wird das Christentum staatlich massiv gefördert. Gerade ist in Moskau eine neue riesige Militärkirche namens „Kirche des Sieges“ eingeweiht worden. Putin selbst und sein treuer Gefolgsmann Medwedew haben sich im Nachhinein eine lange bibeltreue biografische Tradition herbeifrisiert: Putin behauptet, er sei schon 1952 heimlich getauft worden, Medwedew berichtet, er sei mit 23 (1988, als das risikolos war) vom Atheisten zum Gläubigen geworden.
In vielen muslimischen Ländern ist die Bibel verboten, als könnte schon allein das Wort Jesu Christi den muslimischen Glauben und die darauf beruhenden Staaten ins Wanken bringen. Auch Chinas KP hat gerade wieder 48 Kirchen schließen lassen. Begründung: zu viel Bibel, zu wenig Patriotismus.
Dabei kann man die Bibel durchaus im Sinne eines engstirnigen Nationalismus auslegen – wie nicht nur Trump, Putin und Bolsonaro beweisen, sondern auch der Spruch „Gott mit uns“, der von Preußen bis zur Nazizeit auf den Gürtelschnallen deutscher Uniformen stand.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 15. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
_______________________________________________________________________
GESCHICHTE: „DIE GROSSE HURE“
Weinten die Juden wirklich an den Wassern von Babylon?
Nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier 587 v. Chr. wurden viele Juden nach Mesopotamien deportiert. Dort sollen sie sich nach Zion verzehrt haben, heißt es in der Bibel. Das Gegenteil war wohl der Fall.
Von Berthold Seewald
Die Weltstadt Babylon hat keinen guten Ruf in der Bibel. Als „Hure, die an vielen Wassern sitzt“, wird „das große Babylon“ in der neutestamentlichen „Offenbarung“ des Johannes beschrieben, als „die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden“. Als der Text Ende des ersten Jahrhunderts entstand, war Babylon allerdings eine Chiffre für „die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden“, also Rom.
Doch in einem Buch des Alten Testaments ist mit Babylon wirklich die große Stadt am Euphrat gemeint: „Babel, die Verwüsterin“, heißt es im 137. Psalm, der mit einer höchst unchristlichen Verwünschung endet: „Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert.“
Dass Babel zum Inbegriff alles Bösen in der Bibel werden konnte, hat mit zwei Feldzügen zu tun, die der babylonische Großkönig Nebukadnezar II. 597 und 587 v. Chr. gegen Jerusalem führte. Damals wurden zahlreiche Juden, vor allem Angehörige der Elite, nach Mesopotamien verschleppt, wo sie „an den Wassern von Babylon saßen und weinten, wenn wir an Zion gedachten“, so der berühmte erste Satz von Psalm 137 , der Komponisten und Interpreten von Heinrich Schütz bis Boney M. inspiriert hat.
Aber war das Leben im Herzland des babylonischen Großreichs wirklich so entsetzlich, wie die biblischen Zeugnisse vermuten lassen?
Neue Funde weisen in eine andere Richtung. Aufgrund der Analyse
neuedierter Urkunden, die in Jahudu unweit von Babylon entdeckt wurden,
kommt der Dresdner Theologe Ulfrid Kleinert jetzt in der Zeitschrift „Antike Welt “ zu einem anderen Schluss: „Die Keilschrifttexte von Jahudu zeigen, dass die Bewohner des Orts Wert auf ihre Herkunft legten, sich aber zugleich in ihrer neuen Heimat zu Hause fühlten.“
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 02. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
VERSCHWÖRUNGSMYTHEN - EINE DIGITALRELIGION ENTSTEHT
Die Bewegung „QAnon“ wird zur Religion
Korrupte Eliten foltern unterirdisch Kinder, das Coronavirus ist eine Bio-Waffe und Donald Trump der Erlöser. Die Verschwörungserzählungen von „QAnon“ bedienen alte Muster und Feindbilder. Vor allem weiße Trump-Fans fühlen sich angesprochen, doch die Digitalsekte wächst auch außerhalb der USA.
Von Christian Röther
„Wir sind Q“, sagt dieser Mann vor einer Veranstaltung mit US-Präsident Donald Trump. Damit meint er: Wir sind die Q-Bewegung. Auf Trump-Veranstaltungen hört und liest man diese Aussage immer wieder: Wir sind Q! Also Q, der 17. Buchstabe des Alphabets.
„Wir wissen nicht genau, wer Q ist“, sagt dieser Mann einem CNN-Reporter. Deswegen wird Q auch QAnon genannt: Anon, das steht für anonym. Der Mann meint, Q seien wohl mehrere Personen. Auf jeden Fall hätten sie Insider-Informationen und seien „die Guten“.
Was verbirgt sich hinter QAnon?
Bei QAnon geht es um eine angebliche Verschwörung gigantischen Ausmaßes. Die Kurzfassung: Eine verdorbene Elite aus demokratischer Partei, Banken, Medien und so weiter herrsche heimlich über die USA. Und Donald Trump sei von ranghohen Militärs dazu auserwählt worden, diesen „Tiefen Staat“ zu Fall zu bringen, meint auch diese Q-Anhängerin: „Donald Trump was picked by military leaders to run for president as a way to kind of bring down the deep state.“
„Neue amerikanische Religion“
QAnon wird in den USA immer wieder als religiöse Bewegung bezeichnet. Die Parallelen liegen auf der Hand: Es gibt mit Q eine Art Propheten. Der schart Prediger und Anhängerinnen um sich. Tausende sollen es inzwischen sein. Sie verbreiten seine Heilsbotschaft und erwarten eine Art kosmischen Endkampf zwischen Gut und Böse.
Von einer „neuen amerikanischen Religion“ schreibt das Magazin „The Atlantic“, und erinnert an die Siebenten-Tags-Adventisten und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Die seien im 19. Jahrhundert in den USA unter ganz ähnlichen Umständen entstanden: zwar ohne Internet, aber im christlichen Kontext und mit Prophezeiungen, die besagten, dass bald eine neue Zeit anbreche. Das hätte sich zwar nicht erfüllt, die Religionsgemeinschaften gibt es aber bis heute.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 02. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.deutschlandfunk.de
_______________________________________________________________________
GESCHICHTE: „DIE GROSSE HURE“
Weinten die Juden wirklich an den Wassern von Babylon?
Nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier 587 v. Chr. wurden viele Juden nach Mesopotamien deportiert. Dort sollen sie sich nach Zion verzehrt haben, heißt es in der Bibel. Das Gegenteil war wohl der Fall.
Von Berthold Seewald
Die Weltstadt Babylon hat keinen guten Ruf in der Bibel. Als „Hure, die an vielen Wassern sitzt“, wird „das große Babylon“ in der neutestamentlichen „Offenbarung“ des Johannes beschrieben, als „die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden“. Als der Text Ende des ersten Jahrhunderts entstand, war Babylon allerdings eine Chiffre für „die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden“, also Rom.
Doch in einem Buch des Alten Testaments ist mit Babylon wirklich die große Stadt am Euphrat gemeint: „Babel, die Verwüsterin“, heißt es im 137. Psalm, der mit einer höchst unchristlichen Verwünschung endet: „Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert.“
Dass Babel zum Inbegriff alles Bösen in der Bibel werden konnte, hat mit zwei Feldzügen zu tun, die der babylonische Großkönig Nebukadnezar II. 597 und 587 v. Chr. gegen Jerusalem führte. Damals wurden zahlreiche Juden, vor allem Angehörige der Elite, nach Mesopotamien verschleppt, wo sie „an den Wassern von Babylon saßen und weinten, wenn wir an Zion gedachten“, so der berühmte erste Satz von Psalm 137 , der Komponisten und Interpreten von Heinrich Schütz bis Boney M. inspiriert hat.
Aber war das Leben im Herzland des babylonischen Großreichs wirklich so entsetzlich, wie die biblischen Zeugnisse vermuten lassen?
Neue Funde weisen in eine andere Richtung. Aufgrund der Analyse
neuedierter Urkunden, die in Jahudu unweit von Babylon entdeckt wurden,
kommt der Dresdner Theologe Ulfrid Kleinert jetzt in der Zeitschrift „Antike Welt “ zu einem anderen Schluss: „Die Keilschrifttexte von Jahudu zeigen, dass die Bewohner des Orts Wert auf ihre Herkunft legten, sich aber zugleich in ihrer neuen Heimat zu Hause fühlten.“
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 02. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
EIN BUCHTIPP
Das jüdische Interesse an Jesus von Nazaret
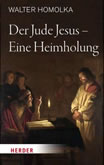
Rabbiner Walter Homolka beschreibt in seinem Buch die wichtigsten jüdischen Perspektiven auf Jesus. Trotz der christlichen Unterdrückung, die Juden im Namen Jesu jahrhundertelang erfuhren, setzten sie sich seit jeher mit Jesus auseinander.
Homolka diskutiert das wachsende jüdische Interesse am Nazarener seit der Aufklärung und wie Juden Jesus heute sehen, im religiösen sowie kulturellen Kontext. Das Buch zeigt: Im Zentrum der Beschäftigung mit dem Juden Jesus steht das Ringen des Judentums um Authentizität und Augenhöhe. Jesu Verankerung im Judentum bietet eine Herausforderung für Christen heute und die Chance auf fruchtbaren jüdisch-christlichen Dialog.
Autor/in

Walter Homolka , Rabbiner und Theologe
Rabbiner Walter Homolka, Dr., geb. 1964, studierte u.a. am Leo Baeck College und King's College London. Der frühere Landesrabbiner von Niedersachsen ist ordentlicher Universitätsprofessor für jüdische Religionsphilosophie der Neuzeitseit und Geschäftsführender Direktor der School of Jewish Theology der Universität Potsdam.
Walter Homolka ist seit 2002 Rektor des Abraham Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam, des ersten Rabbinerseminars in Deutschland seit dem Holocaust. Mitglied im Executive Board der World Union for Progressive Judaism und Vorsitzender des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks
..
Verlag Herder, Freiburg, 1. Auflage 2020, Gebunden 256 Seiten, ISBN: 978-3-451-38356-4, Bestellnummer bei Herder: P383562
AUCH NACH 60 JAHREN ÖKUMENISCHEN DIALOGS
Kurienkardinal Koch:
Weiterhin kein Konsens über Ziel der Ökumene
60 Jahre ökumenischer Dialog zwischen dem Vatikan und nichtkatholischen Kirchen: Doch der Erwartung, es komme in naher Zukunft zu einem Konsens, erteilt Kurienkardinal Kurt Koch nun einen Dämpfer.
Noch nach 60 Jahren ökumenischen Dialogs zwischen dem Vatikan und nichtkatholischen Kirchen besteht laut Kurienkardinal Kurt Koch "kein wirklich tragfähiger Konsens" über die Form einer künftigen Kircheneinheit. Nötig sei eine Klärung, was zur Einheit unabdingbar notwendig sei. Nur so ließen sich in der Ökumene die nächsten Schritte gehen, erklärte der Schweizer Kardinal auf der Internetseite "Vatican News" (Freitag). Die Vorläufer-Einrichtung des von Koch geleiteten Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen wurde am 5. Juni 1960 gegründet.
Die katholische Kirche könne als Universalkirche mit vielen Ortskirchen vormachen, "dass Einheit und Vielheit auch in der Ökumene keine Gegensätze darstellen, sondern sich wechselseitig fördern", sagte Koch. Umgekehrt könne die katholische Kirche von den Orthodoxen über die Kollegialität der Bischöfe lernen. Als "verheißungsvolle Initiative" bezeichnete der Kardinal die Einladung von Johannes Paul II. in der vor 25 Jahren veröffentlichten Ökumene-Enzyklika "Ut unum sint", gemeinsam über die Ausübung der päpstlichen Vorrangstellung nachzudenken.
"Pflicht, an der ökumenischen Bewegung teilzunehmen"
In den einzelnen Bistümern trügen die Diözesanbischöfe die erste Verantwortung für die Einheit der Christen, betonte Koch. Er sprach von einer "Pflicht, an der ökumenischen Bewegung teilzunehmen". Ein im Herbst erscheinender Ökumene-Leitfaden solle den Bischöfen helfen, "ihre ökumenische Verantwortung besser verstehen und verwirklichen zu können", sagte Koch. Mit Blick auf seine eigene zehnjährige Tätigkeit an der Spitze des Einheitsrats sagte der Kardinal, er sei sich "bewusst, dass es nur einen Ökumeneminister gibt, nämlich den Heiligen Geist".
Lesen Sie hier den Beitrag aus INETRNETPORTAL DER KATH: KIRCHE IN DEUTSCHLAND vom 05. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter katholisch.de
RUSSLAND-DEUTSCHE EVANGELIUMS-CHRISTEN
Parallelen zwischen Massen-Ausbrüchen in Frankfurt und Bremerhaven
Sie leben abgeschottet, pflegen einen radikalen Glauben und misstrauen dem Staat. Wieder bricht das Coronavirus in einer Gruppe von russland-deutschen Evangeliums-Christen aus.
Von Reinhard Bingener
Zwischen den aktuellen Corona-Ausbrüchen in einer Kirche in Frankfurt und einer Kirche in Bremerhaven gibt es eine Parallele: In beiden Fällen hat sich die Erkrankung unter „Evangeliums-Christen“ verbreitet, einer von Russlanddeutschen geprägten Sondergruppe. Im Zusammenhang mit der Frankfurter Gemeinde ist die Zahl der Infizierten nach Behördenangaben bis zum Freitag auf 200 gestiegen. Die dortigen Evangeliums-Christen haben inzwischen auch eingestanden, dass in ihren Gottesdiensten auf Mund-Nasen-Bedeckungen verzichtet und dort auch gesungen wurde.
Bei dem neuen Ausbruch in der Region Bremerhaven gibt es bisher 44 Erkrankte. Man müsse jedoch davon ausgehen, dass „die Zahl der Infizierten dreistellig werden kann“, teilte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit. Weil die Angehörigen der Religionsgemeinschaft abgeschottet lebten, sei das Infektionsgeschehen zwar leichter eingrenzbar. Das Problem jedoch ist, dass die Familien der 800 bis 1000 Mitglieder zählenden Gemeinde oft groß sind. Bei einem Ehepaar wissen die Behörden von 16 Kindern. Mittlerweile wurden auch bereits zwei erkrankte Schulkinder identifiziert. Zu der Frage, ob die Bremerhavener Evangeliums-Christen gegen Hygieneauflagen verstoßen haben, machen die Behörden keine Angaben. Die Gemeinde soll die Teilnehmerzahl ihrer Gottesdienste zumindest auf jeweils 150 Personen beschränkt haben. Dem Verdacht, dass die Infektionskette in Bremerhaven mit der Infektionskette in Frankfurt zusammenhängen könnte, sind die Behörden bisher nicht nachgegangen.
Die Bremerhavener Evangeliums-Christen selbst sind für Medienanfragen nicht zu erreichen. Warum das so ist, kann Pfarrer Janusz Blonski von der örtlichen Baptistengemeinde erklären. Blonski berichtet von fehlgeschlagenen Versuchen, die Evangeliums-Christen zu einer Mitarbeit in ökumenischen oder evangelikalen Netzwerken zu bewegen. Bei den Evangeliums-Christen handele es sich zwar ebenfalls um Baptisten. „Aber sie werfen uns vor, dass wir zu weltlich und zu lasch sind. Wir sind für sie verdorben“, berichtet der Pfarrer, in dessen eigener Baptistengemeinde ein striktes Hygienekonzept gilt.
In den Gottesdiensten wird geweint und ekstatisch in Zungen geredet
Die Darlegungen Blonskis über die Evangeliums-Christen aus Bremerhaven decken sich mit dem, was ein anderer Freikirchenpfarrer über die Frankfurter Evangeliums-Christen zu berichten weiß: Das Kennzeichen beider Gemeinden ist eine eigentümliche Frömmigkeit, die sowohl konservativ-traditionelle wie auch extrovertiert-charismatische Züge trägt. Frauen sind angehalten, lange Röcke zu tragen und ihr Haar zu bedecken. Gleichzeitig wird in den Gottesdiensten geweint und ekstatisch in Zungen geredet.
Der Kenner der Frankfurter Evangeliums-Christen ordnet diese Bewegung den „Darbysten“ zu, die nach einem radikalen englisch-irischer Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert benannt sind. Der Darbysmus habe sich in den fünfziger Jahren später auch unter den Russlanddeutschen in der Sowjetunion ausgebreitet, berichtet der Freikirchenpfarrer. Und die damalige Verfolgungssituation wirke bei den Evangeliums-Christen bis heute fort.
Nach jahrzehntelanger Existenz als Hausgemeinde im Untergrund blickten die Evangeliums-Christen mit Skepsis und Ablehnung auf die Maßgaben der staatliche Obrigkeit. An dieser Haltung habe sich auch durch die Umsiedelung nach Deutschland wenig geändert.
Lesen Sie hier den Beitrag aus FAZ Online vom 02. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter faz.net
JAGD AUF KATHOLIKEN
Die "Gordon Riots" brachten England an den Rand eines Umsturzes
Nie stand England dem totalen Umsturz näher als bei den Gordon Riots 1780. Lord George Gordon war ein radikaler Protestant, der mit einer Petition gegen Katholiken mobil machte. Doch dann entglitten ihm die eigenen Leute.
Von Philip Cassier
Die Protestler waren bis ins Londoner Parlamentsgebäude vorgedrungen, ihr Anführer konnte im Plenarsaal zusehen und -hören. Nach Stunden der Diskussion beschlossen die Abgeordneten, die Abstimmung über die eingereichte Petition um einige Tage zu verschieben. Weder Lord George Gordon noch seinen Anhängern war das genug. Als Erzprotestanten hatten sie gefordert, dass Erleichterungen für Katholiken im Vereinigten Königreich wieder zurückgenommen werden.
Gordon bat trotzdem die Leute im Gebäude genau wie die rund 40.000 vor der Tür, ruhig nach Hause zu gehen. Doch das war nur ein frommer Wunsch: In dieser Nacht des 2. Juni 1780 wurden in London katholische Kirchen und Haushalte verwüstet oder sogar in Brand gesteckt, einschließlich der Kapelle der Bayerischen Gesandtschaft in der Warwick Street.
In den Tagen darauf eskalierte die Lage weiter, ein Mob griff Institutionen an, die für Recht und Gesetz standen: Die Gefängnisse von Newgate und Fleet, die Bank of England und die Mautstationen an der Blackfriars Bridge. Im Urteil einiger britischer Historiker waren die Gordon Riots die Tage, in denen England einem Umsturz wie im Frankreich des Jahres 1789 am nächsten stand. Die Armee schritt erst am 7. Juni mit 12.000 Soldaten ein, sie brauchte zehn Tage, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
Etwa 100 Häuser waren geplündert oder niedergebrannt worden, mehr als im Paris der Französischen Revolution. Der Schriftsteller Horace Walpole, Sohn des Premierministers Robert Walpole, notierte am 8. Juni, er habe schon einige brutale Aufstände erlebt: „Aber niemals habe ich vor gestern Nacht London und Southwark in Flammen gesehen.“
Unruhen von einer solchen Dimension haben immer Ursachen, die tiefer liegen, als es der unmittelbare Anlass erkennen lässt. Augenscheinlich ging es um den „Roman Catholic Relief Act“, der 1778 unter der Regierung Georgs III. verabschiedet worden war. Das Gesetz erlaubte englischen Katholiken, Land zu besitzen, zu erben und der Armee beizutreten. Das allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie einen Eid gegen die Ansprüche der katholischen Stuarts auf den Thron und die Zivilgerichtsbarkeit des Papstes leisteten. Obwohl nur ein Prozent der Bevölkerung der Konfession anhing und auch mit dem Gesetz der Zugang zu vielen staatsbürgerlichen Rechten verwehrt blieb, war es dem Vorsitzenden der Protestantischen Gesellschaft Lord George Gordon nicht auszureden, dagegen mit einer Petition mobil zu machen.
Gordons Bemühungen fanden in einem innerlich zerrissenen England einen idealen Nährboden. Der Krieg gegen die aufständischen Siedler in Nordamerika entwickelte sich immer mehr zu einem Fiasko, erst 1779 waren im Süden viele Gebiete verloren gegangen. Auch im Land gärte es: Befürworter und Gegner des Krieges in Übersee standen sich unversöhnlich gegenüber, darüber hinaus gab es Streit darüber, ob der König zu viele oder zu wenige Rechte habe.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 02. 06. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
FAKE-NEWS-FORSCHER
"Die Coronakrise ist auch eine Desinformationskrise"
Um Propaganda und Falschinformationen zu bekämpfen, müssen die Demokratien des Westens die gesamte Kommunikation im Internet regulieren, meint der britische Autor Peter Pomerantsev.
Ein Interview von Nils Minkmar
Lesen Sie hier den Beitrag aus SPIEGEL Online vom 04. 04. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des SPIEGEL Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.spiegel.de
KATHOLISCHE KIRCHE
Stellenausschreibung in der Schweiz: Bistum Chur sucht einen Exorzisten
Eine ungewöhnliche Stellenausschreibung gibt es aktuell im Bistum Chur in der Schweiz. Nach dem Tod des Dompropsts Christoph Casetti sucht die katholische Kirche einen neuen Exorzisten - zum Kampf gegen das Böse und dunkle Mächte.
Vielen Menschen sind Teufelsaustreibungen ungeheuer, verbindet man damit doch dunkle mysteriöse Rituale aus dem Mittelalter. Doch in der Schweiz ist der Exorzismus auch heute noch in der Kirche präsent.
Nach dem Tod von Bischofsvikar Christoph Casetti (76) am Sonntag sucht das Schweizer Bistum Chur einen neuen Exorzisten. Nachfrage bestehe weiterhin, besonders bei Migranten, berichtet das Schweizer Fernsehen (Donnerstag). Mehr als 400 Anfragen gingen jährlich bei der katholischen Kirche ein, hieß es in einem SRF-Beitrag von 2017, fast 1.000 weitere Anfragen habe die Heilsarmee erhalten.
Casetti selbst sprach nicht von Teufelsaustreibung, sondern formulierte im Schweizer Fernsehen, er sei im "Heilungs- und Befreiungsdienst" tätig. Wenn der Bischof die Erlaubnis gebe, könne er auch den "großen Exorzismus" beten. Der Ablauf des Rituals ist in einem lateinisch verfassten Handbuch festgelegt. Dieses sei aber "nur für den Exorzisten bestimmt", schreibt das Bistum Basel.
Menschen verlangen nach Exorzismus
Oft fühlten sich Menschen von "unsichtbaren Mächten" bedroht und wollten sich von diesen befreien, so der Baseler Pressesprecher Hansruedi Huber. "Sie verlangen dann manchmal einen Exorzismus, ohne aber genau zu wissen, was das ist." Seelsorger berieten die Hilfesuchenden, wiesen auch auf psychologische oder psychiatrische Ursachen hin und vermittelten Betreuung.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 18. 02. 2020 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des FOCUS Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.focus.de
KIRCHEN- UND GLAUBENSKRISE
Ohne Wissen über das Christentum hat Europa wenig Zukunft
Die Kirchen in Deutschland leiden unter massivem Mitgliederschwund. Aber was wird aus Europa, wenn die Europäer nicht mehr wissen, wie der Mann am Kreuz heißt und was die Kreuze auf Berggipfeln bedeuten?
Von Eberhard von Gemmingen
Nach allen verfügbaren Prognosen wird die Zahl der getauften Christen in Mitteleuropa rapide schwinden . Es stellt sich die Frage, ob dieser Religionswandel nicht auch größte politische Folgen haben wird. Mitteleuropa steht in einem Kulturbruch. Das zeigt sich jetzt auch an Weihnachten.
Natürlich muss man fragen, warum Religion – konkret der Glaube an Jesus Christus – so schrumpft. Viele werden über die katholische Kirche sagen: weil sie hinter der Moderne her hinkt, weil Frauen nicht auf Augenhöhe mit Männern stehen, nicht Diakoninnen werden, erst recht nicht die Priesterweihe empfangen können. Wegen des Zölibats fehlten Seelsorger, die in den Glauben einführen und ihn feiern können.
Auch habe sexueller Missbrauch von Minderjährigen durch Priester zum Verlust des Vertrauens in die Kirche beigetragen. Die evangelische Kirche hat viele „Hindernisse“ nicht, und dennoch verlassen sie mehr Gläubige, und die Kirchen sind leerer. An der evangelischen Kirche reibt man sich im Unterschied zur katholischen kaum. Das Zentralproblem in Mitteleuropa scheint zu sein, dass Gott nicht mehr „gebraucht“ wird, dass er im Leben der Menschen nicht mehr vorkommt. Manche sprechen von „Gottesfinsternis“.
Es wäre angezeigt, dass Politiker und Gesellschaftswissenschaftler sich die Frage stellen, ob sich durch dieses Verblassen von Religion und Gottesglauben nicht langfristig das gesellschaftliche und politische Denken und Verhalten der Bürger ändert.
Es dreht sich ja bei diesem Verblassen um das Vergessen einer wesentlichen Quelle der europäischen Kultur, eben der christlichen Religion. Denn das europäische Menschenbild und die Gesellschaftsordnung Europas sind ja entscheidend von Judentum und Christentum, konkret vom Dekalog des Moses und der Bergpredigt Jesu geprägt.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 18. 12. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
„FRANZISKUS FÄLLT DIE MASKE DES REFORMERS VOM GESICHT“
In einer beispiellosen Revolte stellen sich deutsche Katholiken gegen den Papst
Trotz Warnschüssen aus dem Vatikan hält die katholische Kirche in Deutschland unbeirrt am Plan fest, den Missbrauchsskandal der Kirche in einem Reformprozess aufzuarbeiten. Zwischen Papst Franziskus und den deutschen Klerikern bahnt sich ein handfester Konflikt an. Konservative Kleriker warnen schon vor einer Abspaltung von Rom.
Die deutschen Katholiken halten an ihrem geplanten Reformprozess fest und steuern damit weiter auf einen Konflikt mit dem Papst zu. Eine zweitägige Vorbereitungskonferenz von rund 50 Bischöfen und Laien endete am Samstag in Fulda „mit einem klaren Appell, den eingeschlagenen Synodalen Weg mutig und engagiert im Geist des Evangeliums fortzusetzen“, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) mitteilte. Der DBK-Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx erinnerte daran, dass die katholische Kirche eine zu allen Menschen gesandte Kirche sei: „Die Kirche ist nicht für sich selber da.“
„Synodaler Weg“: Kleriker fordern Debatte über Zölibat und weibliche Priester
Die deutschen Bischöfe hatten im Frühjahr nach Bekanntwerden des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Kleriker einen Reformprozess beschlossen. Der Missbrauch hat das Vertrauen in die Kirche erschüttert. Die Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) – die Vertretung der Gläubigen – sind sich deshalb einig: Jetzt muss etwas geschehen, sonst sei der Schaden irreparabel.
Lesen Sie hier den Beitrag aus FOCUS Online vom 15. 10. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des FOCUS Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.focus.de
GESELLSCHAFTLICHER WANDEL
Frankreichs Eintritt in die "postchristliche Ära"
Frankreich erlebt heftige Umwälzungen: Die Macht der katholischen Kirche schwindet, Migration verändert das Land. Der französische Politologe Jérôme Fourquet erklärt, was das Verschwinden des Vornamens „Marie“ über die Veränderungen im Land sagt.
Frankreich ist ein Land des rasanten Wandels, eine Aneinanderreihung schwelender Konflikte, die regelmäßig aufbrechen und die Gesellschaft verändern. In den Fantasien der deutschen Nachbarn mag die gute alte Frankreichnostalgie mitunter weiterleben. Durch diese Träume streifen noch immer Männer mit Baskenmütze, die Baguette und Weinflasche nach Hause tragen.
Nicht, dass es sie nicht mehr gäbe. Auch die provenzalischen Märkte mit duftendem Thymian und fetten Feigen, die Gilbert Bécaud besungen hat, existieren noch. Und wer will, der kann sich immer noch in den Fußstapfen von Roland Barthes oder Friedrich Sieburg auf die Suche nach den ewigen Mythen der Nation machen. Die ganze Welt, das hatte Sieburg 1929 verstanden, wollte so leben, wie Frankreich lebt. Aber stimmt das immer noch?
„Das Frankreich von Mbappé hat mit dem Frankreich von Zidane nichts mehr zu tun“, sagt Jérôme Fourquet, ein Mann, der sich an seinem Land abarbeitet wie kaum ein anderer. Als Politologe und Meinungsforscher ist er seit Jahren damit beschäftigt, seinen Landsleuten ihr eigenes Rätsel zu erklären.
Fourquet analysiert Wahlen, erklärt gesellschaftliche Umwälzungen und versucht zu verstehen, wie der Franzose tickt. Besser als jede wissenschaftliche Abhandlung erklärt sein Fußballvergleich, wie es um Frankreich steht: Die Franzosen haben ihre Zuversicht verloren.
Zwanzig Jahre liegen zwischen den beiden Triumphen bei einer Fußballweltmeisterschaft. 1998 war die siegreiche Mannschaft „black-blanc-beur“, gemischt aus schwarzen, weißen und arabischstämmigen Franzosen, ein Symbol für die Republik, die ihre Kraft aus der multiethnischen Gesellschaft speiste und Einwanderer mit noch so unterschiedlichen Wurzeln zu stolzen Franzosen machte.
Von diesem Enthusiasmus war im letzten Sommer nicht mehr viel zu spüren. Der Sieg der Bleus wurde zwar heftig, aber nur kurz gefeiert. Dann verpuffte die Freude schon in einer Staatsaffäre um Emmanuel Macrons präsidialen Sicherheitsmann Alexandre Benalla und bald darauf in einer riesigen sozialen Krise.
Jérôme Fourquet, 46, sitzt in einer klassischen Pariser Brasserie nahe der französischen Nationalversammlung, wo ein Ritual der Franzosen noch immer funktioniert: das Mittagessen. Aber er hält sich an Wasser. Rotwein um 13 Uhr, das ist inzwischen sogar bei Franzosen die Ausnahme.
Sein Buch mit dem Titel „L’Archipel français“ (Frankreich, eine Inselgruppe) steht seit Wochen auf der Bestsellerliste und ist mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden und das, obwohl Fourquet darin viele unbequeme Wahrheiten ausspricht. „Geburt einer multiplen und gespaltenen Nation“ lautet der Untertitel.
Zu seinen Argumenten gehört, dass zwischen der Menge auf den Champs-Élysées, die dem Bus der Nationalmannschaft zujubelte, und den gewalttätigen Ausschreitungen der
Gelbwesten am selben Ort nur wenige Wochen lagen.
Fliehkräfte sind nach Fourquets Ansicht am Werk, seit rund sechs Jahrzehnten schon, die die schöne alte Republik in Einzelteile zerlegt haben, in unzählige Gruppen mit vielfältigen Identitäten und Interessen.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT + Online vom 01. 07. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
MASSENDEMONSTRATIONEN
In Hongkong entscheidet sich, wer die Erde erbt
Hunderttausende Schüler und Studenten demonstrieren mit Ketten und in Häftlingskleidung gegen Pekings repressive Politik. Es ist keine Revolte am Rande der Welt. Es geht um die Zukunft aller.
Von Michael Stürmer
Die Welt ist im Umbruch, nirgendwo gründlicher als im Fernen Osten, der längst nicht mehr fern ist. Täglich erscheint ein Buch über Chinas Vergangenheit, um die Zukunft des Riesenreiches zu entschlüsseln. Aber machtvoller als alle gelehrten Analysen sind die lebenden Bilder aus Hongkong : Schüler und Studenten zu Hunderttausenden mit Ketten und in Häftlingskleidung, die zeigen, was im Fall der Unbotmäßigkeit droht.
Dabei geht es nicht um ein fernes Spektakel, auch nicht um Protest à la Greta, sondern um tödlichen Ernst und die globalen Lebensformen von morgen. Vordergründig geht es um Auslieferung missliebiger Personen aus der Sonderverwaltungszone an Peking.
Hunderttausende demonstrieren gegen Auslieferungsgesetz
In Hongkong haben Hunderttausende gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz protestiert. Mit der neuen Regelung wären erstmals auch Auslieferungen an das chinesische Festland möglich. Es sind die größten Massendemonstrationen seit Jahren.
Doch an der Nahtstelle zwischen Hongkong im vertraglichen Sonderstatus und dem chinesischen Festland entscheidet sich, wer die Erde erbt: die konfuzianische Parteidiktatur, welche Menschen und Medien nach ihrem Bilde formen will, oder Idee und Wirklichkeit der Freiheit westlicher Observanz. Dies ist auch keine Revolte am Rande der Welt, sondern im Epizentrum der digitalen Revolution ein Ringen um Menschen und Macht.
Was vor 30 Jahren auf dem Platz des Himmlischen Friedens – für China Mittelpunkt des Universums –
in Auflehnung gegen die Panzer des Regimes begann und in Blut und Feuer erstickt wurde, ist jetzt als Inspiration einer neuen Generation auferstanden: nicht auf dem Festland, sondern in Hongkong, das damit Versuchslabor der Zukunft weit über Chinas Grenzen hinaus wird.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 10. 06. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
KATHOLISCHE KIRCHE
Papst führt Meldepflicht für sexuellen Missbrauch ein
Papst Franziskus hat ein neues Kirchengesetz verkündet.
-
Alle Geistlichen, Mönche und Nonnen müssen jeglichen sexuellen Missbrauch melden, der ihnen bekannt wird.
- Damit soll Vertuschungsaktionen entgegengewirkt werden, die bei den Missbrauchsskandalen eine große Rolle spielten. Papst Franziskus hat für die gesamte katholische Kirche eine Meldepflicht für Fälle sexuellen Missbrauchs erlassen. Für Kleriker und Ordensleute werde ab Juni die Verpflichtung eingeführt, innerhalb der Kirche Missbrauchs- und Vertuschungsfälle umgehend anzuzeigen, teilte der Vatikan mit.
„Während diese Verpflichtung bis dato in einem gewissen Sinne dem persönlichen Gewissen überlassen war, wird sie nunmehr zu einer universell gültigen Rechtsvorschrift“, erklärte der Chefredakteur der Kommunikationsabteilung des Vatikans, Andrea Tornielli. Das Gesetz soll am 1. Juni in Kraft treten. Eine Meldepflicht an staatliche Stellen ist allerdings nicht vorgesehen.
In dem apostolischen Schreiben „Vos estis lux mundi“ (Ihr seid das Licht der Welt) heißt es zudem,
die katholischen Diözesen in aller Welt müssten bis spätestens Juni nächsten Jahres „ein oder mehrere dauerhafte und der Öffentlichkeit leicht zugängliche“ Anlaufstellen für Anzeigen einrichten.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 09. 05. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
INDIVIDUALISIERUNG
Kirchen sind wie Parteien, deren Markenkern schwindet
Die Gotteshäuser lassen uns hängen, weil sie selbst nicht mehr an sich und ihr „Geschäftsmodell“, wie es heute so schön heißt, glauben. Und dies, obwohl die Menschen Tiefsinn und Gemeinschaftlichkeit suchen.
Ich habe einen Freund, der sich immer sehr über Katholiken aufregt. Katholische Priester sind für ihn sowieso durch die Bank Kinderschänder , aber er sieht auch überall Katholikenverschwörungen am Werk. Ich finde Diskussionen mit ihm manchmal etwas anstrengend, weil ich, als vor 30 Jahren aus der Kirche ausgetretene Protestantin, offenbar überhaupt kein Sensorium für die unvorstellbaren Tücken der im Geheimen netzwerkenden Katholiken habe.
Wahrscheinlich gehöre ich zu der wachsenden Zahl von Deutschen – Islamisten natürlich ausgenommen –, die der Religion gleichgültig bis ignorant gegenüberstehen. Und die damit dafür sorgen, dass unsere beiden großen Kirchen bis 2050 die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren werden – weil die alten Gläubigen wegsterben, weil Leute wie wir unsere Kinder nicht taufen lassen oder weil Kinder, die aus Versehen doch noch getauft wurden, beim ersten Blick auf den Kirchensteuerabzug von ihrer Gehaltsabrechnung die Flucht ergreifen.
Die Menschen glauben an Engel
Parallel zu dieser nachlässigen Entfremdung nimmt interessanterweise der Wunderglaube in der Bevölkerung zu; und auch die Zahl der Menschen, die an Engel glauben. Was zeigt, dass wir trotz aller Diesseitigkeit immer noch nach irgendeinem Sinn des Lebens suchen, nach einer höheren Geborgenheit, nach Transzendenz und nach irgendetwas nach dem Tod.
Mich beschleicht langsam der Gedanke, dass es ein Fehler war, aus einer Organisation auszutreten, die, zumindest dem Ideal nach, unsere Gesellschaft zusammenhält. Einer Organisation, die gegen die krasse Individualisierung unserer Tage immer noch einen gemeinsamen Glauben setzt und außerdem ziemlich grundsätzliche Bildung vermittelt.
Oder wenigstens vermittelte, als der Konfirmandenunterricht keine reine Stuhlkreisveranstaltung war.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 05. 05. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de
DEUTSCHLAND
Kirche befürchtet Halbierung der Mitgliedszahlen
Bis zum Jahr 2060 müssen die Kirchen laut einer Studie mit einem Mitgliederrückgang um 49 Prozent rechnen. Hauptgrund sind laut der Untersuchung der Universität Freiburg Austritte und ausbleibende Taufen. Kardinal Reinhard Marx sieht die Studie als "Aufruf zur Mission".
Die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt weiter drastisch. Bis zum Jahr 2060 könnte laut einer Studie mit einem Rückgang um 49 Prozent auf 22,7 Millionen zu rechnen sein. Die Hauptgründe sind Austritte, weniger Taufen sowie die alternde Bevölkerung, wie eine Untersuchung der Universität Freiburg zeigt.
Der Abwärtstrend könnte auch zu dramatischen Finanzierungslücken bei den Kirchen führen. Die Studie des Forschungszentrums Generationenverträge wurde am Donnerstag gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlicht. Die Forscher legten ihrer „Projektion 2060“ unter anderem demografische Daten und Erkenntnisse zu vergangenen „Wanderungsbewegungen von Kirchenmitgliedern zwischen den Diözesen“ zugrunde.
Den demografischen Faktor – Überalterung und Bevölkerungsrückgang – macht die Studie lediglich zu einem Drittel für die prognostizierte Entwicklung verantwortlich. Stärker ins Gewicht fielen andere Faktoren wie Austritte oder das Tauf- und Aufnahmeverhalten. Weil mehr Menschen aus der Kirche austreten und zugleich immer weniger Kinder getauft werden, fehlt es der Kirche an gläubigem Nachwuchs.
Darüber zeigte sich der Leiter der Studie, der Finanzwissenschaftler Prof. Bernd Raffelhüschen, überrascht.
Den Kirchen böte sich damit zugleich die Chance, Strategien etwa zur Verhinderung von Austritten zu entwickeln. Wichtig für deren Einnahmen sei gerade die steuerstarke obere Mittel- und Oberschicht.
Lesen Sie hier den Beitrag aus WELT Online vom 02. 05. 2019 zu Ende.
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des WELT Online. Weitere interessante Beiträge aus Politik, Gesellschaft und Religion unter www.welt.de




 Prof. Joachim Fest
Prof. Joachim Fest Claus Jacobi
Claus Jacobi Prof. Dr. Michael Stürmer
Prof. Dr. Michael StürmerB.Strauss_SV.jpg) Marcel Reich-Ranicki
Marcel Reich-Ranicki Dr. Edmund Stoiber
Dr. Edmund Stoiber Mainhardt Graf von Nayhauß
Mainhardt Graf von Nayhauß Danièle Thoma.
Danièle Thoma.