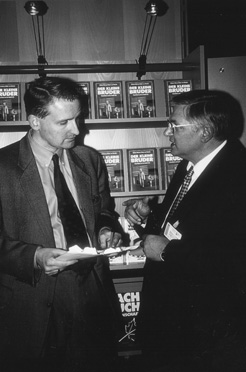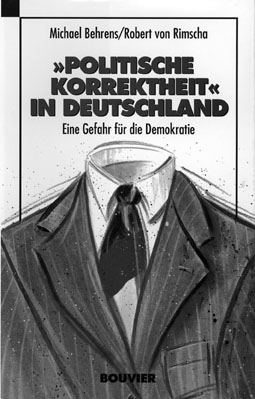Michael Behrens, Jahrgang 1964, aufgewachsen in den USA und im Libanon, Studium der Politologie, Geschichte und Staatswissenschaft in Bonn und Pullman, WA, USA. Arbeitet seit 1991 für die DEUTSCHE WELLE in Köln, wo er als Fernsehredakteur und Moderator tätig war. Anschließend Programm- und Medienreferent des Intendanten. Seit 1997 Leiter de des Englischen Programms der DW.
TENDENZEN: Herr Behrens, die Hauptthese Ihres Buches "Der kleine Bruder - Deutschland und das Modell USA" lautet: "Deutschland muß die USA kopieren, um essentiell Deutsches zu erhalten. Nur wenn wir die freiheitlichen Werte Amerikas übernehmen, können wir Wohlstand in Deutschland auch künftig garantieren." Wo sehen Sie die Grenzen des "Kopierens"?
Behrens: In der Universität sagt man zu Studenten "(Fax)- Kopieren heißt nicht kapieren". Dasselbe gilt auch für das "Modell USA". Blinde, unüberlegte Übernahme amerikanischer Verhaltensweisen und Muster kann und darf nicht gelten. Aber wir sollten sehr wohl die Trends beobachten, die in den USA fünf bis zehn Jahre vorher aufbrechen als in Deutschland. Denn diese wirtschaftlichen und sozialen Strömungen erreichen - im Zeitalter des Globalismus - auch die europäische Gegenküste. Also wäre es ein Zeichen von Ignoranz, wenn wir diesen Vorsprung nicht nutzen würden.
Der wichtigste Trend ist der zu mehr Freiheit - und unter freiheitlichen Werten verstehen Herr v. Rimscha und ich vor allem Selbstverantwortung. Der Kommunismus ist tot, der Sozialismus à la Tony Blair und Gerhard Schröder ist nicht mehr vom linken Weltverbesserungstum geprägt. Ein Staat kann nicht alle Probleme lösen, das Individuum, die Familie, kurz, das Prinzip der Subsidiarität ist gefordert. Dafür steht das "Modell USA".
TENDENZEN: Offenbart nicht gerade die amerikanische Variante des Kapitalismus bisweilen auch dunkle Seiten, die sich in ungeheuren sozialen Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft niederschlagen? Oder andersherum gefragt: Was ist vom Gedanken Richard von Weizsäckers zu halten, der sagt, die Zivilisation des Kapitalismus wird die Herausforderung des 21. Jahrhunderts sein?
Behrens: Herr v. Weizsäcker steht für die alte Bundesrepublik-West vor 1989. Wenn er von "Zivilisation des Kapitalismus" spricht, dann vertritt er die Meinung, die Konsensgesellschaft sei das Maß aller Dinge. Und er stellt sich unter Konsens den typisch deutschen Einheitsbrei, das fröhliche Miteinander von Parteien, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften vor. Das ist aber - in der Welt nach 1989 - nicht mehr zeitgemäß. Der US-Politologe Francis Fukuyama vertritt in seinem Buch "The End of History" die These, daß nach dem Ende des Ost-West Konfliktes die Demokratie zwar gesiegt habe, es aber dafür Spannungen innerhalb dieser Demokratien gebe. Und: ist das schlimm? Nur unter Spannungen können sich Demokratien auch weiterentwickeln, das "Modell USA" lebt seit über zwei Jahrhunderten unter diesem Motto - und es ist gut damit gefahren. Warum soll das nicht bei uns, ein halbes Jahrhundert nach der Staatengründung, auch gut sein. Konsens zumindest stand bisher noch allzuoft als Synonym für Stillstand.
TENDENZEN: Müssen wir Deutsche immer von anderen lernen? Ist nicht das Experiment "von Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen" in der ehemaligen DDR kläglich gescheitert? Soll das jetzt heißen: "Von USA lernen, heißt Siegen lernen"? Gibt es denn nichts, was die USA von uns Deutschen lernen könnten?
Behrens: Die Deutschen brauchen nicht von morgens bis abends über die Landesgrenzen zu schielen. Und "von der Sowjetunion lernen" war kein freiwilliger Akt, sondern durch die sowjetische Machtpolitik auferzwungen. Zu Recht ist dieser "Lernerfolg" nach 1989 verpufft. Trotzdem ist es nicht falsch, an erfolgreichen Modellen Maß zu nehmen. Kein Land, kein Wert besteht an sich, sondern immer nur im Verhältnis zu anderen. Man selbst kann sich schwerlich der eigene Maßstab sein.
Wir selbst haben es schwer, den Amerikanern etwas "anzubieten". Deutschland ist inzwischen ein "newly declining country", ein Land auf dem Abstieg. Hier und dort reisen noch US-Bildungspolitiker über den Atlantik, um beim deutschen dualen Bildungssystem Anleihen zu nehmen - das ist es aber auch schon. Erst wenn wir wieder mehr Mut zur Freiheit haben, können die lobenswerten, "typisch-deutschen" Eigenschaften, von den Grünen als "Sekundärtugenden" diskreditiert, wieder zum Blühen gebracht werden. Erfindertum, Fleiß oder wissenschaftliche Fundiertheit sind Pfunde, mit denen wir im 21. Jahrhundert sehr wohl wuchern können.
TENDENZEN: Läßt sich dies, was Sie in Ihrem Buch schreiben, auch auf religiöse Systeme übertragen? Im Klartext: Warum tun sich religiöse Systeme amerikanischer Prägung in aller Welt und hier speziell in Deutschland so schwer (z.B. Mormonen, Zeugen Jehowas)? Müßten diese und ähnliche religiöse Gemeinschaften trotz des amerikanischen Ursprungs doch nicht ihren besonderen deutschen Weg suchen?
Behrens: Amerikas Kirchengeschichte ist eine ganz andere als die deutsche. Amerika entstand als eine "city upon a hill", als Vorstellung eines neuen Jerusalems. Sektierertum, rivalisierende Kirchen waren prägend für Amerika. Deutschland dagegen kannte seit der Reformation bis zum Zuzug der muslimischen, zumeist türkischen Minderheiten, den katholischen, protestantischen und, bis Holocaust, jüdischen Glauben. Von daher haben es religiöse Systeme amerikanischer Prägung schwerer - eine Masseneinwanderung ist nicht zu erwarten, im Bereich des Konvertierens stehen sie in "Konkurrenz" zu einer Vielzahl neuer, esoterischer Sekten. Ein gewisses Maß an "Anpassung" an deutsche Gegebenheiten ist zu erwarten. In der Welt des Glaubens gibt es - im Gegensatz zur Weltwirtschaft - keine Globalisierung.
TENDENZEN: In Amerika gibt es einige interessante und zum Teil bedenkliche Entwicklungen auf dem religiösen Gebiet (z.B. Promise Keepers). Zusätzlich versuchen viele religiöse Gruppen sowohl über die republikanische als auch demokratische Partei politischen Einfluß zu gewinnen - auch wenn z.Zt. noch sowohl das Präsidenten-Paar Clinton als auch sein Vize, Al Gore, Sympathien für die New-Age-Spiritualität zeigen. Was ist von Amerika noch - womöglich als Modell - religiös zu erwarten?
Behrens: In den USA findet gegenwärtig, nach dem Ausklang der 68er', eine Welle neuer Spiritualität statt. Die Suche nach dem Sinn des Lebens führt zum Erstarken traditioneller, religiöser Gefühle und Werte sowie dem Zulauf zu Sekten. Mit einer gewissen Zeitverzögerung ziehen diese beiden Entwicklungen über den Atlantik. Hinzu kommt als dritte Strömung in beiden Ländern die zunehmende Zahl derer, denen Religion überhaupt nichts bedeutet. Dieser Trend ist aber in Deutschland, prozentual betrachtet, sehr viel stärker als in den USA. Grund hierfür ist der Kommunismus in der früheren DDR, der fast zur vollständigen Ausradierung des christlichen Glaubens geführt hat.
Im religiösen Bereich ist vor allem eine Revitalisierung des christlichen Glaubens im weiteren Sinne, vor allem jüngerer Eltern, zu erwarten. In einer Zeit zunehmender Orientierungslosigkeit werden sich zunehmend junge Mütter und Väter an dem moralischen Imperativ der 10 Gebote orientieren und diese ganz praktisch auf das moderne Leben anwenden, wie in den USA. Beispiel: Eltern, die gegen die Gewalt im Fernsehen protestieren werden
Der kleine Bruder

Michael Behrens
Der kleine Bruder
Deutschland und das Modell USA
Bouvier Verlag
Bonn, 2002
199 Seiten, gebunden
DM 38,-
ISBN : 3-416-02712-4
Können Deutschland und die USA voneinander lernen, um im globalen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen? Ja, aber Deutschland wird dabei der kleine Bruder sein, es wird eher auf der Schulbank sitzen als am Katheter stehen. Das Amerika der zweiten Clinton-Administration hat bereits seine Hausaufgaben gemacht. in Deutschland dagegen versuchen eine neoliberale FDP, eine gemäßigt sozialdemokratische CDU und eine SPD, die sich an Bergarbeitern und nicht Chip-Herstellern orientiert, eine Marschordnung für das 21. Jahrhundert festzulegen. Und die Gewerkschaften scheuen Risiko und Eigenverantwortung. Der Lernprozeß wird also in weiten Bereichen eine Einbahnstraße sein - Deutschland wird das sehr viel flexiblere Amerika kopieren und seine Lesungen adoptieren müssen, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu können.
Die Linke lehnt Amerikas hire-and-fire, McJobs und den Sozialabbau ab. Die Rechte lehnt die Verwässerung kultureller Normen, Amerikas multikulturelle Welt im eigenen Land, ab. Beide Lager irren in ihrem Amerika-Bild. Sie schaden damit Deutschland.
Die Journalisten und Amerika-Experten Michael Behrens und Robert von Rimscha berichten über die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche, in denen sich beide Länder auch künftig etwas zu sagen haben. Sie haben mit Dutzenden von Entscheidungsträgern gesprochen, haben Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks interviewt. Denn die Zukunft der Beziehungen beruht auf der Einsicht, daß beide Nationen globalen Herausforderungen unterliegen. Obwohl es paradox klingt: Deutschland muß die USA kopieren, um essentiell Deutsches zu erhalten. Nur wenn wir die freiheitlichen Werte Amerikas übernehmen, können wir Wohlstand in Deutschland auch künftig garantieren.
Beide Autoren erhielten den "Arthur-F-Burns-Preis" des Auswärtigen Amtes für deutsch-amerikanische Berichterstattung.
"Politische Korrektheit" in Deutschland
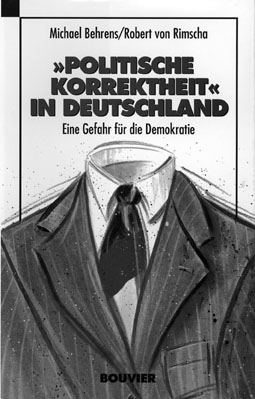
Michael Behrens
"Politische Korrektheit" in Deutschland
Eine Gefahr für die Demokratie
2. erw. Auflage
Bouvier Verlag
Bonn,
189 Seiten, gebunden
DM 39,80,-
ISBN : 3-416-02598-9
Pluralismus, Streitkultur und Meinungsfreiheit sind gefährdet, wo Verhalten, öffentliche Stellungnahmen und Sprache einer bis ins Detail gehenden Normierung folgen sollen. Eine solche weltverbesserische Harmonielehre dringt derzeit als Political Correctness in Deutschland ein. Ihr Versuch, als von unbestreitbaren Moral-Grundsätzen geprägt daherzukommen, macht sie zu einer Gefahr. Wachsende gesellschaftliche Gegensätze werden verkleistert durch die Vision der Heilung sozialer und ideologischer Verschiedenheit mittels Sprache. Der alte deutsche Traum von Ganzheit und Vollkommenheit verstellt den Blick auf Realitäten und Möglichkeiten.
Doch während in den USA die Political Correctness längst im erbitterten Proteststurm vor allem der Populärkultur wankt, beginnt die Normierungssucht in Deutschland erst. Ihre Spielwiesen sind mannigfach, ihre Lösungen Scheinlösungen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht durch große ,,Innen" erreicht, die eigene Geschichte nicht durch abgesagte Ausstellungen und Fußballspiele an Hitler-Geburtstagen konfrontiert, die wachsen. de ethnische Vielfalt in Deutschland nicht durch sprachregelnde Ausländerbeauftragte in ihrer Bedeutung erkannt.
Die Autoren besichtigen die Politische Korrektheit in den USA und spüren sie in Deutschland auf.: Ein Appell für die nötige Akzeptanz der Vielfalt und für die Kultur des Dissens.


 Prof. Joachim Fest
Prof. Joachim Fest Claus Jacobi
Claus Jacobi Prof. Dr. Michael Stürmer
Prof. Dr. Michael StürmerB.Strauss_SV.jpg) Marcel Reich-Ranicki
Marcel Reich-Ranicki Dr. Edmund Stoiber
Dr. Edmund Stoiber Mainhardt Graf von Nayhaußen
Mainhardt Graf von Nayhaußen Danièle Thoma
Danièle Thoma